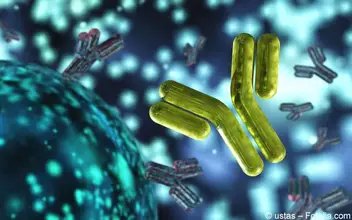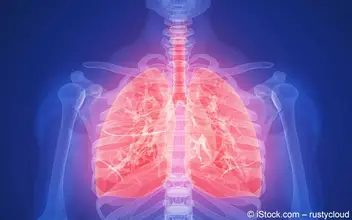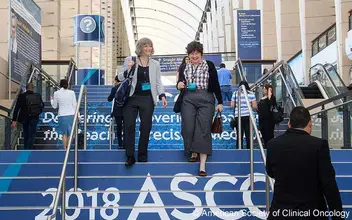Morbidität und Mortalität von cholangiozellulären Karzinomen nehmen weltweit zu. In den USA werden jährlich 10.910 neue Fälle registriert, 3.700 Patienten versterben daran. Die Therapieerfolge sind bisher frustrierend.
Professor Michel Ducreux, Leiter der Gastrointestinalen Abteilung des Gustave Roussy Instituts in Villejuif (Frankreich) und Professor für Onkologie an der Universität Paris, analysierte in seinem Vortrag auf dem ESMO 2018 in München die Gründe für das Scheitern vieler Therapieansätze in den vergangenen Jahren und präsentierte neue Optionen [1].
Verfehlte Ansätze
Gegen cholangiozellulären Karzinome wurden in den letzten Jahren verschiedenste Therapeutika der klassischen Chemotherapie und Tyrosinkinase-Inhibitoren (TKI) einzeln und in den unterschiedlichsten Kombinationen eingesetzt. Ducreux etwas sarkastische Metaanalyse zum Erfolg dieser Therapien: „Egal wie häufig man Null addiert, es bleibt Null.“
Molekulare Heterogenität der Karzinome
Cholangiozelluläre Karzinome umfassen nach Lokalisation drei Arten: Gallenblasenkrebs sowie extra- und intrahepatischen Gallengangskrebs. Molekularbiologisch bietet sich ein weit vielfältigeres Bild als nur drei Tumorarten. So lassen sich allein elf verschiedene Tyrosinkinasen in unterschiedlicher Zusammensetzung in den Tumoren finden. Bestimmte Verteilungsmuster können in einer Lokalisation häufiger anzutreffen sein, aber letztendlich haben die Cholangiokarzinome weit mehr Gesichter und individuelle Eigenschaften als bisher angenommen und bei der Therapie berücksichtigt wurden.
Manchmal reicht ein einfacher Bluttest
Die genaue Bestimmung des individuellen molekularen „Fingerabdrucks“ des Tumors und eine darauf abgestimmte Zusammenstellung der Wirkstoffe ist, laut Ducreux, die Voraussetzung für eine erfolgreiche Therapie. Bei intrahepatischen Tumoren mit mutierter Isozitrat-Dehydrogenase (IDH 1-2) scheinen beispielsweise die Wirkstoffe Enasidenib und Ivosidenib erfolgreich zu agieren. Dabei ist der Test auf mutierte IDH laut Ducreux vergleichsweise einfach: „Sie brauchen nur ein bisschen Blut. Wenn Sie darin 2-Hydroxyglutarat (2 HG) nachweisen können, haben Sie auch mutiertes IDH 1 und 2 nachgewiesen.“
Ermutigende Ergebnisse in MOSCATO-Studie
So einfach funktioniert das von Ducreux geforderte Screening natürlich nicht. Als Beispiel für eine erfolgreiche Studie mit allerdings sehr geringen Patientenzahlen nennt er die MOSCATO-Studie [2]. In dieser wurde jeder Therapie ein umfassendes molekulares Screening vorangestellt und die Therapie auf die Ergebnisse dieses Screenings hin abgestimmt. Dadurch konnte man für die Patienten gegenüber der vorangegangenen Therapie eine Verdopplung der progressionsfreien Zeit erreichen. Ducreux wünscht sich nun mehr Studien, um seine Hypothese zu evaluieren.