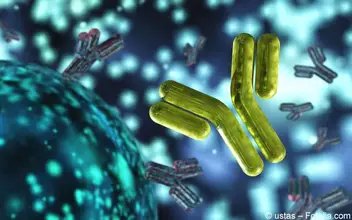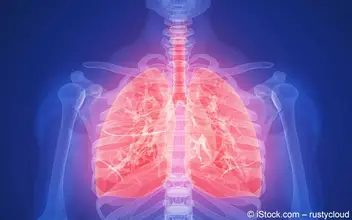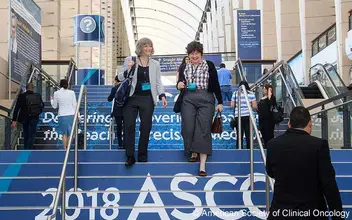Die Immuntherapie wird die Krebsbehandlung revolutionieren. Davon ist Dr. Solange Peters von der Onkologie Abteilung des Zentralen Universitätsklinikums Lausanne und ESMO President elect für die Periode 2020-21 überzeugt. In ihrem Vortrag auf dem ESMO Kongress 2018 untermauerte Peters ihre Prognose für die onkologische Therapie mit Zahlen: „Bisher sind 26 Immuntherapeutika zugelassen. Rund 2000 immuntherapeutische Agenzien befinden sich aber derzeit in den verschiedenen Phasen der präklinischen und klinischen Entwicklung und Zulassung.“
Um sich von dieser gewaltigen Welle nicht überrollen zulassen, ist es wichtig aus den bisher gemachten Erfahrungen zu lernen. Für die Therapie des nicht-kleinzelligen Lungenkrebses (NSCLC) bestehen für Checkpoint-Inhibitoren, insbesondere PD(L)- Inhibitoren, die bislang meisten Erfahrungen. Daher hat Peters gezielt 13 Lektionen zum Einsatz dieser immuntherapeutischen Therapieoption beim NSCLC zusammengestellt.
Lektion 1: Die Hemmung des PD-1 Signalwegs ist erfolgreich
PD(L)-1 Checkpoint-Inhibitoren, wie Nivolumab und Pembrolizumab, die PD-1 auf der T-Zelle binden, sowie Atezolizumab, Avelumab und Durvalumab, die am PD-L1 auf der Tumorzelle agieren, sind querbeet gegen viele Subtypen des fortgeschrittenen NSCLC aktiv und weitgehend sicher.
Lektion 2: Pharmakokinetik beachten
Nach der ersten Behandlung mit PD(L)-1 Checkpoint-Inhibitoren ist mit einem Abfall der Wirksamkeit an den Zielen zu rechnen. Wiederholte Gaben können die Wirksamkeit überproportional verlängern.
Lektion 3: Immuntherapie ist im Gehirn aktiv
Die Ansprechrate der Gehirnmetastasen entspricht mit 33% der systemischen Response-Rate (RR) bei NSCLC und ist dauerhaft.
Lektion 4: Management der Toxizität
Die Toxizität von Checkpoint-Inhibitoren ist vielfältig und betrifft fast alle Körperregionen und -systeme. Aber mittlerweile ist diese Toxizität relativ gut in den Griff zu bekommen. Aktuelle Leitlinien der ESMO [2] und der Society for Immunotherapy of Cancer (SITC) [3] sind veröffentlicht.
Lektion 5: Exaktes Matching von Patient und Therapie
Bei der Therapieentscheidung müssen sowohl Tumor-abhängige Eigenschaften als Patienten-abhängige Faktoren berücksichtigt werden. Nur so kann eine effektive Therapie, bei der der Nutzen die Risiken überwiegt, erzielt werden.
Lektion6: Biomarker für Toxizität
Wenn möglich müssen Biomarker auch gezielt als Prädiktoren für die Toxizität von Therapeutika genutzt werden.
Lektion 7: Bei Lebermetastasen Therapieoptionen überdenken
Lebermetastasen haben einen negativen Vorhersagewert für den Nutzen der Immun-Mono-Therapie, daher müssen in diesen Fällen andere Therapieoptionen erwogen werden.
Lektion 8: EGFR-Mutationen
Für eine sinnvolle Therapiewahl ist eine molekulare Testung entscheidend. Die Erfahrung zeigt, dass NSCLC mit EGFR-Mutationen nicht gut auf eine Anti-PD(L)-1 Therapie ansprechen. Hier sollten von vorneherein andere Therapieoptionen erwogen werden.
Lektion 9: Es gibt Langzeitüberlebende
Bei einer medianen Überlebensrate (OS) von 9,9 Monaten, gibt es jedoch auch Langzeitüberlebende des NSCLC. Im ersten Jahr überleben nur rund 42%, aber die Kurve flacht sich dann zusehends ab, so dass nach 5 Jahren immerhin noch 16% Patienten leben. Die besten Chancen für ein relativ langes Leben trotz NSCLC haben Raucher mit hoher PD-L1 Expression und hoher Tumormutationslast (TMB). Die schlechteste Prognose haben Patienten mit EGFR-Mutationen.
Lektion 10: Kombinationen von Checkpoint-Inhibitoren
Anti CTLA-4 und anti-PD(L)-1 Kombinationen sind effektiv und weniger abhängig von der PD-L1 Expression. Allerdings führten behandlungsabhängige Nebenwirkungen wie Pneumonie, Leberschäden, Kolitis und Diarrhoe bei einem Drittel der Patienten zu einem Abbruch der Therapie.
Lektion 11 Kombination mit Radiotherapie
Bei der Kombination von Immuntherapie und Radiotherapie beobachtet man interessante Synergien. Die Überlebensrate durch eine Kombination beider Therapien kann sich gegenüber einer Monotherapie verdoppeln bis verdreifachen.
Lektion 12: Die Vielfalt der Möglichkeiten gezielt nutzen
Im klinischen Werkzeugkasten stehen heutzutage viele scharfe Instrumente zur Aktivierung einer effektiven Anti-Tumor-Immunität zur Verfügung. Wichtig ist, dass man sich vor dem Einsatz dieser Instrumente klar macht, welches zugrundeliegende Immunitätsproblem behoben werden muss.
- Bei einem „kalten“ Tumor, der selbst keine Immunantwort auslöst, muss eine primäre Reaktion, zum Beispiel durch adoptive T-Zell-Therapie, CAR-T oder zielgerichtete Therapien, generiert werden.
- Eine erschöpfte oder suboptimale Immunantwort kann durch Checkpoint-Inhibitoren in Mono- oder Kombinationstherapie unterstützt werden.
- Wenn die Immunantwort durch Faktoren im Mikroumfeld des Tumors unterdrückt wird, sind Therapiestrategien wie beispielsweise Antiangiogenese oder die Beeinflussung des Adenosin- oder Tryptophan-Stoffwechsel möglich.
Lektion 13: Resistenzen müssen charakterisiert werden
Resistenzen werden durch Defizite bei der Erkennung, der T-Zell-Aktivität oder -Mobilität verursacht. Eine erworbene Resistenz für Checkpoint-Inhibitoren der PD-1 Achse ist häufig auf wenige Lokalisationen, meist Lymphknoten, beschränkt. Die Kombination lokaler Therapien und anti-PD(L)-1 kann die Wirksamkeit verlängern.
Fazit
Zur Auswahl von Erstlinien-Immuntherapien ist eine präzise Onkologie gefragt. Biomarker müssen vor der Therapieentscheidung sorgfältig überprüft werden. Der Langzeitnutzen und die Nachhaltigkeit sind kritisch zu hinterfragen. Grundsätzlich muss die Charakterisierung von Biomarkern noch verfeinert werden. Synergistische Kombinationen können die Therapieergebnisse verbessern. Die Behandlung früher Stadien muss intensiviert werden, setzt aber eine funktionierende Früherkennung voraus.