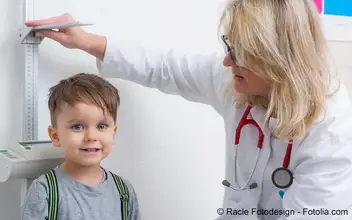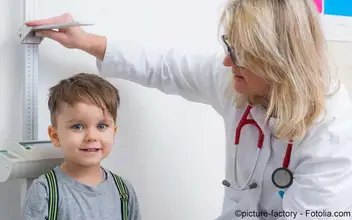Migräne ist eine belastende Kopfschmerzerkrankung unter der etwa 10% der Kinder (<12 Jahre) und Jugendlichen (12-17 Jahre) leiden. Die optimale Behandlung umfasst neben einer evidenzbasierten Akutbehandlung, einer präventiven Therapie auch die Identifizierung und Behandlung komorbider Störungen. Zwar wird angenommen, dass bei Kindern und Jugendlichen mit Migräne internalisierende Symptome, definiert als die Tendenz einer Person, auf Stress mit inneren Prozessen (z. B. Angst, depressive Symptome) zu reagieren, und psychiatrische Störungen (z. B. Angst, depressive Störung) erhöht sind – aussagekräftige Beweise hierfür existieren jedoch nicht.
80 Migräne-Studien einbezogen
Um diese Lücke zu schließen, entschlossen sich Dr. Katherine Falla von der Cumming School of Medicine, University of Calgary in Kanada, und Kollegen, die Datenbanken MEDLINE, Embase, PsycInfo und CINAHL nach Studien zu durchforsten, die den Zusammenhang zwischen Angst- und Depressionssymptomen bei Kindern und Jugendlichen mit Migräne untersuchten. Von den 4.946 gescreenten Fall-Kontroll-, Kohorten- und Querschnittsstudien schlossen die Wissenschaftler 4.866 aus. Übrig blieben 80 Untersuchungen, von denen Falla und Team 13 (16,3%) als qualitativ hochwertig, 46 (57,5%) als mäßig hochwertig und 21 (26,2%) als qualitativ minderwertig einstuften. Als primären Endpunkt wählten die Wissenschaftler die Migränediagnose.
Zusammenhang zwischen Migräne, Angst und Depressivität gefunden
Die Überprüfung der 80 einbezogenen Studien zeigte, dass
- ein Zusammenhang zwischen Migräne und Angstsymptomen besteht, wobei die Wissenschaftler eine große Effektstärke beobachteten (n=16 Studien; standardisierte mittlere Differenz [SMD] 1,13; 95%-Konfidenzintervall [KI] 0,64 bis 1,63; I2-Statistik [I2] = 96%)
- es einen Zusammenhang zwischen Migräne und depressiven Symptomen gibt. Die Effektstärke war in diesem Fall moderat (n=17 Studien; SMD 0,67; 95%-KI 0,46 bis 0,87; I2=89,7%)
- Kinder mit Migräne im Vergleich zu solchen ohne Migräne eine signifikant höhere Wahrscheinlichkeit für Angststörungen (n=15 Studien; Quotenverhältnis [Odds Ratio, OR] 1,93; 95%-KI 1,49 bis 2,50; I2=61,3%) und depressive Störungen (n=18 Studien; OR 2,01; 95%-KI 1,46 bis 2,78; I2=57,8%) aufweisen
- Kinder und Jugendliche mit Migräne signifikant häufiger unter internalisierenden Symptomen leiden als Kontrollpersonen, wobei eine große Effektgröße beobachtet wurde (n=10 Studien; SMD 0,88; 95%-KI 0,66 bis 1,09; I2=63,9%)
- die Wahrscheinlichkeit für gemischte internalisierende Störungen ebenfalls erhöht ist (n=9 Studien, die über die gepoolte Prävalenz von Angst- und/oder depressiven Störungen berichteten; OR 4,69; 95%-KI 3,08 bis 7,14; I2=82,2%)
Bei der Stratifizierung der Ergebnisse wurden keine Unterschiede zwischen klinischen und gemeinde- bzw. bevölkerungsbasierten Stichproben festgestellt (Ausnahme: Gemischte internalisierende Störungen) und die Begg-Tests ergaben alle keine Hinweise auf Publikationsverzerrungen (p>0,05).
Routinemäßige Untersuchung auf Angst und depressive Symptome
Da Kinder und Jugendliche mit Migräne im Vergleich zu gesunden Kontrollpersonen etwa doppelt so häufig Angst- und Depressionssymptome sowie Angst- und depressive Störungen aufweisen, könnte laut den Autoren ein routinemäßiges Screening auf diese in der klinischen Praxis sinnvoll sein. Unklar bleibt, ob Angst- und Depressionssymptomen oder -Störungen bzw. internalisierende Symptome oder Störungen die Ergebnisse oder die Häufigkeit von Migräne beeinflussen. Allerdings berichteten von acht Studien, die den Zusammenhang zwischen depressiven Symptomen und Migräneergebnissen untersuchten, sieben (87,5%), dass höhere depressive Symptome mit einer schlechteren Migräne einhergingen.
Stärken und Limitationen des Migräne-Reviews
Die Arbeit der kanadischen Wissenschaftler weist mehrere Stärken und Grenzen auf. Um einen unvoreingenommenen Überblick über die verfügbare Literatur zu erhalten, bezogen Falla und Kollegen Studien in allen Sprachen ungeachtet, ob die Daten für eine Metaanalyse ausreichten, in ihren systematischen Review ein. Zudem bündelten die Forscher Assoziationsdaten und führten Sensitivitätsanalysen durch, um robuste Ergebnisse zu garantieren. Zu den Limitationen zählen unter anderem das erhöhte Verzerrungsrisiko durch nicht gemessene Störfaktoren sowie die schlechte Qualität der 21 in die Untersuchung einbezogenen Studien (26,3%). Auch war es Falla und Team aufgrund der unzureichend Berichterstattung in den Originalstudien nicht möglich, ihre Ergebnisse weiter zu stratifizieren z. B. nach Kopfschmerzhäufigkeit (z. B. episodische vs. chronische Migräne) und Geschlecht.