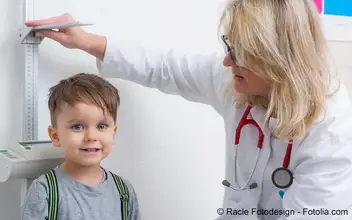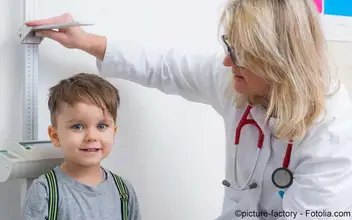Angeborene Herzfehler (AHF) kommen bei ca. 1% aller Lebendgeburten vor und bilden die häufigsten angeborenen (kongenitalen) Anomalien.
Als häufigste sind folgende Defekte zu nennen:
- Ventrikelseptumdefekte
- Atriumseptumdefekte
- Persistierendes Foramen ovale
- Persistierender Ductus arteriosus Botalli
- Aortenisthmusstenose
- Stenosen der Pulmonal- oder Aortenklappe
- Fallot-Tetralogie
Die Ursachen sind in 85% der Fälle multifaktoriell, bei nur 10% geht man von einer primären genetischen Disposition aus. Pränatale Einflüsse, wie eine maternale Grunderkrankung, Medikamenten- oder Drogeneinnahme, sind in 5% der Fälle für die Herzfehler ursächlich. Hierbei spielt der vulnerable Zeitraum der Herzentwicklung, die 3. bis 8. Schwangerschaftswoche, eine wichtige Rolle.
Symptome bzw. Komplikationen sind, abhängig von der jeweiligen Pathophysiologie, Zeichen der Herzinsuffizienz, Herzrhythmusstörungen und Endokarditis.
Die (Früh-)Diagnostik der angeborenen Herzfehler
Die Diagnostik von AHF mit nicht-invasiver Bildgebung umfasst Echokardiografie, Computertomografie (CT) und Magnetresonanztomografie (MRT).
Das Team um Meinrad Beer beschäftigte sich in einem Review mit der nicht-invasiven kardialen Bildgebung von angeborenen Herzfehlern bei Kindern und Jugendlichen.
Es wird ein Überblick über die aktuellen etablierten Methoden zur Diagnose, Differenzialdiagnose sowie Prognose gegeben. Zusätzlich werden neuste Entwicklungen vorgestellt, welche vor allem die Verbesserung der räumlichen und zeitlichen Auflösung, die Verringerung der Kontrastmittelmenge und die Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) betreffen.
Auswahl der Studien und Einschlusskriterien
Die systematische Literaturrecherche wurde nach PRISMA 2020-Leitlinien (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) durchgeführt.
Im Juni und November 2022 wurde die Datenbank MEDLINE nach geeigneten Artikeln durchsucht.
Die Suche beschränkte sich auf Originalstudien in Peer-Review-Fachzeitschriften mit einer verfügbaren Zusammenfassung, wobei keine Beschränkungen hinsichtlich des Veröffentlichungsdatums gemacht wurden.
Ziel war es, Studien zu identifizieren, die den Wert bildgebender Verfahren bei Kindern und Jugendlichen mit Herzkrankheiten bewerten, wobei der Schwerpunkt auf neue bildgebende Verfahren gelegt wurde.
Einschlusskriterien waren im Einzelnen
- Originalforschung
- Ausreichend große Patientengruppe
- Fokus auf einer pädiatrischen Patientengruppe
Echokardiografie
Die transthorakale Echokardiografie ist das am häufigsten eingesetzte nicht-invasive Instrument zur Diagnose und Nachsorge von Patienten mit vermuteten oder bekannten Herzerkrankungen. Dabei kann sowohl die Morphologie als auch Funktionalität des Herzens beurteilt werden.
Im Vergleich zu dem Standardablauf in der Erwachsenenkardiologie erfordert die Untersuchung bei pädiatrischen Patienten einen segmentalen Ansatz. Untersucht werden hierbei:
- Lage des Herzens im Thorax
- Atrialer Situs
- Veno-atriale Verbindungen
- Atrio-ventrikuläre Verbindungen
- Beziehung zwischen den Ventrikeln
- Ventrikulo-arterielle Verbindungen
- Großen Arterien.
Zu den jüngsten Entwicklungen in der funktionellen Echobewertung gehören das Strain Imaging und die dreidimensionale Echokardiografie.
Strain Imaging
Unter dem Strain Imaging versteht man die Beurteilung der Deformation (Strain) des Myokards. Diese Methode wird zur Beurteilung der ventrikulären Funktion eingesetzt. Sie ermöglicht die Messung regionaler Unterschiede in der Kontraktion (Dyssynergie) oder Synchronisation (Dyssynchronie).
Genutzt werden dafür die regionale systolische Verformung (Dehnung) oder die Rate der regionalen Verformung (Dehnungsrate). Die verwendeten Methoden sind dabei Gewebedoppler oder Speckle-Tracking.
Eine Kombination von Strain Imaging und einem Stress-Echo ist möglich, um die diagnostische Sensitivität für die frühzeitige Erkennung einer ventrikulären Dysfunktion zu erhöhen. Besonders für Patientengruppen mit subklinischen Dysfunktionen, wie bei AHF, Krebsüberlebende oder bei hämatologischen Erkrankungen ist diese Möglichkeit zur Früherkennung von Bedeutung.
Drei-dimensionale Echokardiografie
Die drei-dimensionale Echokardiografie (3DE) ermöglicht eine detaillierte anatomische Beurteilung der Herzpathologie, insbesondere Klappenvitien und Kardiomyopathien, aber auch zur präoperativen Planung.
Für Kinder gewinnt die 3DE aufgrund ihrer guten akustischen Fenster sowie der nicht-invasiven Technik an Bedeutung.
Schnittbildverfahren: kardiales CT und MRT
Für die Diagnosestellung und zum Ausschluss weiterer Differenzialdiagnosen ist sind kardiale CT und MRT mittlerweile unverzichtbar.
Im Vergleich zur CT, ist die MRT ein strahlenfreies Verfahren, mit dem sowohl die Funktionalität beurteilt als auch das Herz morphologisch dargestellt werden kann. Trotzdem haben technische Fortschritte in der CT-Diagnostik dafür gesorgt, dass sie immer häufiger in der kardiologischen Pädiatrie zur Anwendung kommt.
Computertomografie: Darstellung der Koronararterien
Der wichtigste Einsatz der CT bei Kindern, ist die Darstellung der Koronargefäße und damit die Erkennung oder der Ausschluss von Anomalien. Zusätzlich kommt die CT bei der Beurteilung von komplexen angeborenen Herzerkrankungen bei Neugeborenen und generell bei Kindern mit Kontraindikationen für MRT zum Einsatz.
Neben den Standard-Single-Source-CT-Scannern gibt es seit fast zwei Jahrzehnten auch Dual-Source-High-End-Scanner (DSCT), bei welchen mit geringerer Dosis und höherer zeitlicher Auflösung gearbeitet werden kann. Nachteilig sind die hohen Kosten, weshalb die Verfügbarkeit an kleineren Standorten nur eingeschränkt möglich ist.
Als Alternative gibt es die Photon-Counting-CT-Technologie, bei welcher die Strahlendosis ebenfalls reduziert werden kann, die Bildqualität und die allgemeine diagnostische Genauigkeit allerdings vergleichbar gut sind.
MRT: viele Vorteile, viele Möglichkeiten?
Die MRT wird vor allem zur Feststellung kongenitaler Herzerkrankungen und Myokarditis eingesetzt, kommt zunehmend aber auch in der Kardio-Onkologie und der fetalen Kardiologie zum Einsatz. Moderne MRT-Geräte haben eine immer bessere zeitliche und räumliche Auflösung und ermöglichen eine Atem-unabhängige Untersuchung.
Die halbautomatische Untersuchung umfasst bspw. die Autokalibrierung, macht freies Atmen möglich, die gleichzeitige Darstellung des EKG, halbautomatische Definition von Bildebenen und automatische Nachbearbeitung. Das ermöglicht eine unkompliziertere Anwendung und Beurteilung und unterstützt somit die Dezentralisierung in der Krankenversorgung.
Eine weitere neue Möglichkeit ist die Kombination mehrerer Methoden, was die Planung und Durchführung verschiedenster Interventionen unterstützt und vereinfacht.
Die KI ist hier fester Bestandteil bei der Bildfusion und wird später noch ausführlicher behandelt.
Mapping-Technologie ersetzt LGE und T2-gewichtete Darstellung
Beim Mapping können durch bestimmte MRT-Sequenz-Techniken Relaxationszeiten bestimmt werden, um sowohl qualitativ als auch quantitativ Myokardveränderungen zu identifizieren. Die Vorteile sind vielfältig: neben der Quantifizierung, kann auch die Gadolinium-Menge reduziert werden, denn die potenziell schädliche Wirkung von Gadolinium wird immer wieder diskutiert.
Zusätzlich besteht die Möglichkeit zur MRT-Angiografie sowie Fluss-Analysen. Aktuelle Methoden umfassen dafür mehrere Zyklen von Kontrastmittel zur Erstellung von zeitaufgelösten Angiografien. Solche Flussanalysen kommen bei Klappenvitien und der Beurteilung von Shunts zum Einsatz.
Die 2D-Darstellung wird für eine schnelle und zuverlässige Bestimmung der Strömungshämodynamik eingesetzt (z. B. Volumina, Geschwindigkeiten, Flussrichtung einschließlich Regurgitationen).
Neuere 4D-Techniken zeigen die Volumina in der gleichzeitigen Darstellung des gesamten Herzens. Letzteres muss jedoch erst noch in Routineuntersuchungen integriert werden.
Neue Anwendungsbereiche der MRT
Anwendung in der pädiatrischen Kardio-Onkologie
Ein neuer Anwendungsbereich der nicht-invasiven Bildgebung ist die pädiatrische Kardio-Onkologie.
Es konnte gezeigt werden, dass asymptomatische pädiatrische Krebspatienten unter Anthrazyklin-Therapie abnorme Strain-Parameter entwickeln können, welche mit der MRT frühzeitig festgestellt werden können. Zusätzlich konnte hierbei eine Korrelation zwischen Bildgebungsparametern von entzündlichen Markern wie der Matrix-Metalloproteinase 7 (MMP7) beobachtet werden.
Noch empfindlicher - zumindest für frühe Stadien von Anthrazyklin-induzierten Kardiotoxizität - könnten strukturelle Parameter wie das T2- oder T1-Mapping sein.
In einer experimentellen Studie konnten außerdem Bildgebungsparameter für die Diagnostik und den Verlauf einer Doxorubicin-Kardiomyopathie ausgemacht werden.
Pränataldiagnostik: fetale Kardio-MRT
Die MRT als nicht-invasive Bildgebung kommt auch in der pränatalen Diagnostik zum Einsatz. So kann bereits vor der Geburt das kardiologische Gating beurteilt werden.
Dafür stehen verschiedene Methoden zur Verfügung. Das Metric Optimized Gating (MOG) und das Self-Gating sind indirekte Methoden, während das Doppler-Sonographie-Gating (DUS) eine direkte Methode darstellt und ähnlich dem EKG sensitiv für Herzaktionen ist.
Somit wird eine hochmoderne kardiale Bildgebung mit der Beurteilung der kardialen Morphologie ermöglicht.
Allerdings müssen die Scanbewegungen der mütterlichen Atempause angepasst werden. Zu berücksichtigen ist außerdem die geringe fetale Größe und schwankende Herzfrequenz von 110 bis 180 pro Minute, weshalb eine hohe räumliche und zeitliche Auflösung notwendig ist, welche aber durch die Gating Methoden möglich gemacht wird.
Limitierend sind derzeit die nicht-beeinflussbaren Kindsbewegungen, Methoden zur Kompensation dieser sind Forschungsgegenstand zur weiteren Verbesserung der Bildqualität.
Künstliche Intelligenz
Der Hauptanwendungsbereich der Künstlichen Intelligenz ist derzeit die Datenerfassung zur Erstellung von KI-basierten Algorithmen. Dabei soll eine signifikante Verringerung der Untersuchungszeit erreicht werden, insbesondere bei der MRT.
Bereits jetzt sind erste Sequenzen für die Bildgebung des Gehirns und Bewegungsapparates verfügbar. In Zukunft sollen auch für die Kardiologie KI-unterstützte Bildsequenzen zur Diagnostik verfügbar gemacht werden. Somit soll auch hier eine Anwendung an mehr Standorten ermöglicht werden.
In der CT kann die Dosis durch neue technische Entwicklungen, wie z. B. der iterativen Rekonstruktion, reduziert werden. Die Autoren gehen davon aus, dass durch den Einsatz von KI eine weitere Dosisreduktion stattfinden werden kann.
In aktuellen Veröffentlichungen zu AHF hat sich außerdem gezeigt, dass die KI-unterstützte Bildinterpretation hilfreich für die Entwicklung neuer prognostischer Instrumente ist.
Fazit
Die nicht-invasive kardiale Bildgebung bei Kindern und Jugendlichen ist eine der wichtigsten Säulen der modernen Diagnostik und Therapie bei entzündlichen und strukturellen Herzerkrankungen sowie kongenitalen Herzfehlern.
Neue Bereiche der klinischen Anwendung sind die Kardio-Onkologie und die fetale Herz-MRT.
Durch die verfügbaren modernen Techniken konnte die Menge an Kontrastmittel und Strahlendosis reduziert werden. Zusätzlich wurden die Untersuchungszeit und Zeit für die Datenauswertung verkürzt.
Technische Entwicklungen können außerdem dazu beitragen, dass die Anwendung dieser Bildgebungsverfahren nicht nur in spezialisierten Zentren stattfinden, sondern auch in der breiteren Krankenversorgung zum Einsatz kommen können.
Aufgrund der steigenden Prävalenz durch die normale Lebenserwartung von Patienten mit AHF wird diese Entwicklung auch immer notwendiger. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz begünstigt und vereinfacht diesen Prozess.
Es bestehen keine Interessenskonflikte, das Review wurde vom Projekt DEAL finanziell unterstützt.