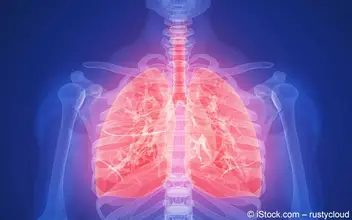Hintergrund
Das Bronchialkarzinom ist mit fast 1,8 Millionen Todesfällen im Jahr 2020 weltweit die häufigste Ursache für die Sterblichkeit aufgrund von Krebs. Ungefähr 85% der Fälle entfallen auf das nicht-kleinzellige Bronchialkarzinom (non small cell lung cancer [NSCLC]). Patienten mit einer Erkrankung im Frühstadium (I-II) wird im Allgemeinen eine Behandlung mit kurativer Absicht, chirurgische Resektion oder radikale Strahlentherapie, angeboten.
Patienten in fortgeschritteneren Erkrankungsstadien werden üblicherweise mit chirurgischer und adjuvanter Chemotherapie oder Chemoradiotherapie und gegebenenfalls mit Immun-Checkpoint-Inhibitoren behandelt.
Biomarker mit hoher Spezifität und Sensitivität für den Nachweis einer minimalen Resterkrankung (minimal residual disease [MRD]) könnten Patienten mit Rückfallrisiko, und diejenigen, die am meisten von einer zusätzlichen adjuvanten und/ oder Erhaltungstherapie profitieren könnten, besser identifizieren, während eine Überbehandlung von Patienten, die erfolgreich geheilt wurden, vermieden werden könnte.
Mit neuen Methoden kann patientenspezifische zirkulierende Tumor-DNA (circulating tumor desoxyribonucleic acid [ctDNA]) bis zu einer Allelfrequenz im Plasma von weniger als 0,003% minimalinvasiv nachgewiesen werden. Der Zusammenhang mit klinischen Ergebnissen ist noch unklar.
Zielsetzung
Eine Arbeitsgruppe um Davina Gale vom Cancer Research UK Cambridge Institut in Großbritannien untersuchte, ob ctDNA-Spiegel im Plasma von Patienten mit NSCLC im Frühstadium, die nach der Behandlung bestimmt wurden, für die Vorhersage von Behandlungsergebnissen geeignet sind [1].
Methodik
Die Wissenschaftler analysierten 363 serielle Plasmaproben von 88 Patienten mit NSCLC im Frühstadium (48,9%/ 28,4%/ 22,7% im Stadium I/II/III), überwiegend Adenokarzinomen (62,5%). 61 Patienten hatten eine Operation, 8 Patienten eine Operation und eine adjuvante Chemotherapie/ Strahlentherapie und 19 Patienten eine Chemoradiotherapie erhalten, jeweils mit kurativer Absicht.
Somatische Mutationen wurden mittels Tumor-Exom-Sequenzierung identifiziert und das Plasma wurde mit patientenspezifischen Assays mit bis zu 48 Amplikons analysiert. Damit sollten tumorspezifische Varianten erfasst werden, die für jeden Patienten einzigartig sind.
Ergebnisse
ctDNA wurde vor der Behandlung bei 24%, 77% und 87% der Patienten mit Erkrankung im Stadium I, II und III und in 26% aller Längsschnittproben nachgewiesen. Die nachgewiesene mittlere Tumorfraktion betrug 0,042%, wobei die Werte bei 63% der Proben bei unter 0,1% und bei 36% der Proben bei unter 0,01% lagen.
Der ctDNA-Nachweis hatte eine klinische Spezifität von mehr als 98,5% und ging dem klinischen Nachweis des Rezidivs des Primärtumors um einen Median von 212,5 Tagen voraus. Der Nachweis vor der Behandlung war mit einem kürzeren Gesamtüberleben und rezidivfreien Überleben verbunden (Hazard Ratio [HR] 2,97 und 3,14, P-Werte 0,01 bzw. 0,003).
ctDNA wurde nach der Behandlung bei 18 von 28 (64,3%) Patienten nachgewiesen, bei denen ein klinisches Rezidiv ihres Primärtumors vorlag. Der Nachweis innerhalb des entscheidenden Zeitrahmens von zwei Wochen bis vier Monaten nach Behandlungsende war bei 17% der Patienten positiv und mit einem kürzeren rezidivfreien Überleben (HR 14,8; P < 0,00001) und Gesamtüberleben (HR 5,48; P < 0,0003) verbunden.
ctDNA wurde ein bis drei Tage nach der Operation bei 25% der Patienten nachgewiesen, war jedoch nicht mit einem Rezidiv der Krankheit assoziiert.
Fazit
Die Studiengruppe schlussfolgerte aus ihren Ergebnissen, dass der personalisierte ctDNA-Nachweis die Erkennung von MRD und Rezidiven unterstützt. Er kann als empfindliches Instrument zur Identifizierung von Patienten mit hohem Rückfallrisiko verwendet werden, die von einer zusätzlichen adjuvanten Therapie profitieren können oder für die Aufnahme in klinische Studien in Frage kommen. In Zukunft könnten ctDNA-Tests auch die Identifizierung von Patienten mit geringerem Rückfallrisiko ermöglichen, für die weniger intensive oder kürzere Behandlungszyklen in Betracht kommen könnten.
Die Wissenschaftler halten größere Studien und prospektive klinische Studien für erforderlich, um eine Abwägung zwischen Nutzen und Schaden bei der weiteren Behandlung von Patienten nach der Erstbehandlung mit kurativer Absicht vornehmen zu können, wenn ctDNA selbst mit hochempfindlichen Assays nicht nachgewiesen wird.
Die Arbeit wurde von der University of Cambridge, Cancer Research UK (Fördernummern A20240, C9545/A29580) und dem Europäischen Forschungsrat unter dem Siebten Rahmenprogramm der Europäischen Union (ERC Grant Agreement Nummer 337905) finanziell unterstützt.