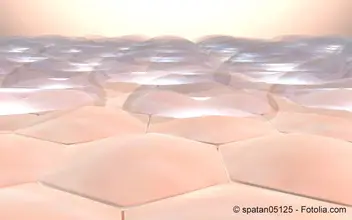Hintergrund
Den meisten Ärzten sind die zahlreichen möglichen schwerwiegenden Nebenwirkungen einer anhaltenden systemischen Kortikosteroidgabe, wie zum Beispiel Typ-2-Diabetes (T2D) bekannt. Daher werden diese häufig mit Vorsicht und für kurze Zeiträume verschrieben.
Topische Kortikosteroide (KS) werden häufig zur Behandlung von entzündlichen Hauterkrankungen wie Ekzemen und Psoriasis eingesetzt. Sie wurden ursprünglich für die kurzfristige Anwendung entwickelt, aber in vielen dermatologischen Leitlinien wird heute eine langfristige Erhaltungstherapie empfohlen.
Obwohl in den Packungsbeilagen topischer KS Hyperglykämie und Glykosurie als unerwünschte Arzneimittelwirkungen beschrieben werden, ist unklar, ob die Anwendung topischer KS tatsächlich mit einem erhöhten Risiko für T2D verbunden ist.
Zielsetzung
Ein Team dänischer und britischer Wissenschaftler um Yuki Andersen vom Herlev and Gentofte Hospital der University of Kopenhagen in Dänemark führte zwei Fall-Kontroll-Studien mit Daten dänischer und britischer sowie eine große Kohortenstudie mit Daten dänischer Patienten durch, um die diabetogenen Effekte topischer Kortikosteroidformulierungen zu untersuchen [1].
Methodik
Für die Fall-Kontroll-Studien griffen die Forscher auf routinemäßig erhobene Gesundheitsdaten aus Dänemark und Großbritannien aus dem Zeitraum zwischen 2007 und 2015 zurück. Sie identifizierten insgesamt 115.218 erwachsene Personen in Dänemark und 54.444 Personen in Großbritannien als Patienten mit neu aufgetretenem T2D und ordneten diesen eine bezüglich Geschlecht und Alter vergleichbare Anzahl an Personen ohne Diabetes zu.
Die dänische Kohortenstudie basierte auf Daten aus den Jahren 2001 bis 2015. Es wurden 2.689.473 Erwachsene eingeschlossen. 1.051.080 dieser Personen wurden während des Studienzeitraums topische Kortikosteroide verschrieben, 1.638.393 Personen nicht.
Anschließend ermittelten die Forscher für die vier Jahre vor der Diabetesdiagnose auf der Grundlage von Verschreibungen Informationen zur Kortikosteroidexposition, deren Dauer und Wirksamkeit. Der Schwerpunkt lag auf der Exposition gegenüber topischen KS. Der primäre Ergebnisparameter war eine Neuerkrankung an T2D.
Ergebnisse
Die Anwendung topischer KS war sowohl in der dänischen (adjustiertes Quotenverhältnis [OR] 1,35 [95%-Konfidenzintervall [KI] 1,33-1,38]) als auch in der britischen Fall-Kontroll-Studie signifikant mit einer Neuerkrankung an T2D assoziiert (adjustierte OR 1,23 [95%-KI 1,19–1,27]).
Personen, die topische KS erhalten hatten, hatten ein signifikant erhöhtes Risiko für eine Erkrankung an T2D (adjustiertes Risikoverhältnis 1,27 [95%-KI 1,26–1,29]).
In den beiden dänischen Studien beobachteten die Forscher signifikante Dosis-Wirkungs-Beziehungen zwischen T2D und zunehmender Stärke topischer KS. Die Ergebnisse zeigten sich über alle Sensitivitätsanalysen hinweg konsistent.
Fazit
Andersen und Kollegen schließen aus ihren Daten auf eine positive Assoziation zwischen der Verschreibung aktueller KS und Neuerkrankungen an T2D bei Erwachsenen in Dänemark und in Großbritannien. Angesichts der hohen Verschreibungsrate halten sie weitere Sicherheitsbeurteilungen für notwendig. Kliniker sollten sich möglicher diabetogener Wirkungen starker topischer KS bewusst sein und andere Therapieoptionen in Betracht ziehen.
Aus Sicht deutscher Experten erscheinen die beschriebene Assoziation zwischen topischen Kortikosteroiden und T2D denkbar und auch interessant, allerdings noch kein Grund, die gängige Praxis zu ändern. Nach PD Dr. Martin Hartmann, Oberarzt an der Universitäts-Hautklinik Heidelberg, sollten topische Kortikosteroide erst dann vorsichtiger gehandhabt werden, nachdem prospektive Daten die vorliegenden Ergebnisse bestätigt haben. Therapeutische Alternativen könnten Tacrolimus oder Pimecrolimus sein. Aber auch hier sollte erst sorgfältig auf langfristige Nebenwirkungen geprüft werden [3].