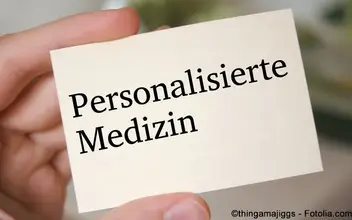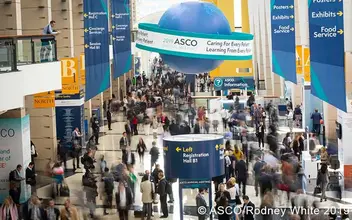Krebs zehrt – am ehesten zehrt eine Tumorerkrankung dabei die Muskulatur auf, weil es der schnellste Weg ist, an Energie zu kommen. Auch durch die bei Malignomen entstehenden inflammatorischen Prozesse wird viel Eiweiß aufgezehrt.
Wer ausreichend Muskelmasse mitbringt, übersteht Chemotherapien besser, hat insgesamt eine verbesserte Chance auf Heilung oder zumindest auf ein längeres Gesamtüberleben im Vergleich zu den weniger Muskelbepackten, wie Professor Dr. Kristina Norman von der Berliner Charité erläuterte.
Besonders bei den Dicken: Körperzusammensetzung analysieren
Das Körpergewicht bzw. der Body Mass Index sind für die Prognosestellung lediglich ungefähre Anhaltspunkte. Auch Übergewichtige können unter dem Fett nur wenig Muskulatur haben – man spricht von der sarkopenen Adipositas.
Um den Patienten bei Muskelaufbau zu helfen und damit ihre Prognose zu verbessern, muss zunächst der Ernährungszustand, und auch der Anteil der fettfreien Köpermasse festgestellt werden, das heißt eine Analyse der Körperzusammensetzung erfolgen. Das betrifft besonders diejenigen, die auf den ersten Blick als übergewichtig erscheinen.
Energiezufuhr bei normalgewichtigen Patienten
Die allgemeinen Empfehlungen für normalgewichtige Krebspatienten sehen eine Energiezufuhr von 30 kcal /kg/Tag vor. Eine besondere Rolle spielt bei der Ernährung bei Krebspatienten das Protein. So sollten an Protein täglich 1,2–1,5 g Protein/Aminosäuren pro Kilogramm Körpergewicht und Tag zugeführt werden [1].
Besonders unter einer Chemotherapie liegt jedoch die tägliche Eiweißaufnahme von Tumorpatienten weit darunter: 66% haben eine Eiweißaufnahme unter einem Gramm pro Tag [2].
Proteine und Training bei sarkopenen Patienten entscheidend
Leider fehlen gerade für die sarkopenen adipösen Patienten spezifische evidenzbasierte Ernährungsempfehlungen, beklagte Norman. Bei ihnen muss individuell über die Zusammensetzung der Kost entschieden werden. Auf jeden Fall muss sie sehr eiweißreich sein und: es muss trainiert werden, damit die Proteine auch in Muskelaufbau umgesetzt werden.
Auch dieses Training muss individuell angepasst werden und schließt sowohl Kraft-, als auch Ausdauertraining mit ein. Damit lassen sich über verschiedene Mechanismen das Immunsystem stabilisieren, die Entzündungsprozesse zurück fahren, metabolische Parameter verbessern und den oxidative Stress vermindern. Dies alles resultiert dann auch in einer erhöhten Fitness, besseren Lebensqualität, geringeren Fatigue und vor allem in einer verminderten Mortalität [3], wie Norman zusammenfasste.