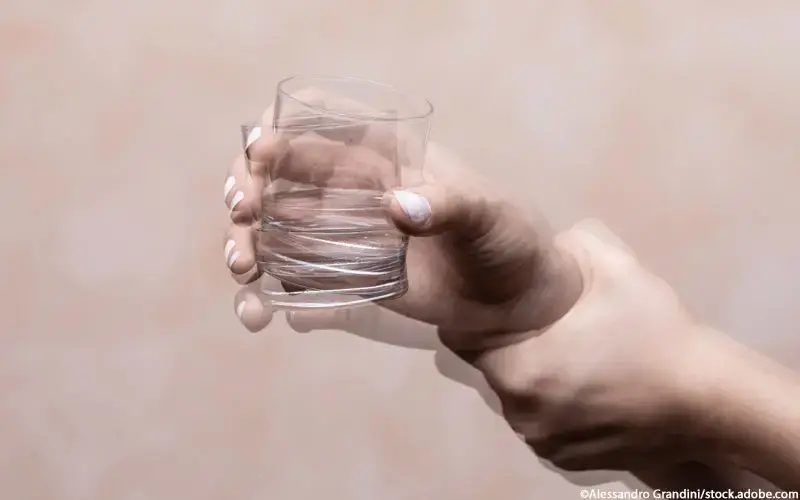
Der Tremor gehört zu den häufigsten Bewegungsstörungen. Definiert wird ein Tremor als eine unwillkürliche oszillatorische rhythmische Bewegung. Man unterscheidet zwischen einem physiologischen Tremor und einem pathologischen Tremor. Ein bekanntes Beispiel für einen physiologischen Tremor ist das Zittern bei Kälteexposition. Hintergrund eines pathologischen Tremors sind häufig Störungen im extrapyramidalmotorischen System, beispielsweise bei Parkinson. Der Übergang zwischen physiologischem und pathologischem Tremor ist fließend. Ein pragmatischer Ansatz ist, einen Tremor als pathologisch zu klassifizieren, wenn man den Tremor mit bloßem Auge sehen kann.
Aktualisierung unter Beteiligung zahlreicher Fachgesellschaften
Eine Orientierung zur Diagnostik und Therapie von Patienten mit Tremor bietet die S2k-Leitlinie „Tremor“, die seit 2008 vorliegt. Eine aktualisierte Version wurde im August 2022 unter Federführung von Professor Dr. Günther Deuschl, Kiel, und der Assoziierten Professorin Dr. Petra Schwingenschuh, Graz, veröffentlicht [1]. Es handelt sich um die zweite Überarbeitung, die erste war im Jahr 2012 erfolgt. Beteiligt Fachgesellschaften waren unter anderem die Deutsche Gesellschaft für Neurologie (DGN), die Österreichische Gesellschaft für Neurologie (ÖGN) sowie die Schweizerische Neurologische Gesellschaft (SNG).
Die Leitlinie gibt zunächst einen Überblick zur Definition und Klassifikation des Tremors. Die klinische Beschreibung soll laut Leitlinie in den meisten Fällen eine syndromatische Klassifikation des Tremors erlauben. In der Leitlinie werden die Tremor-Syndrome wie folgt unterteilt:
- Isolierte Aktions- und Ruhetremorsyndrome
- Fokale Tremores
- Aufgaben- und Positionsspezifische Tremores
- Orthostatische Tremores
- Mit prominenten Zusatzsymptomen
- Sonstige (Funktioneller Tremor, unklassifizierbarer Tremor).
Anschließend wird auf die verschiedenen Tremor-Formen gesondert eingegangen.
Neuerungen der Leitlinie
In die überarbeitete Version der Leitlinie sind Neuerungen zur Klassifikation und Therapie verschiedener Tremor-Formen eingeflossen, auf die im Folgenden eingegangen wird. Im Leitlinien-Dokument sind alle Neuerungen gleich zu Beginn zusammengefasst. Danach folgt eine Übersicht zu den wichtigsten Empfehlungen.
Essentieller Tremor plus
Neu ist eine Abgrenzung zwischen Essentiellem Tremor (ET) und Essentiellem Tremor plus (ET+), [2]. Die Diagnose eines ET+ wird laut Leitlinie gestellt, wenn eines von den genannten neurologischen Symptomen (soft signs) vorliegt: leicht gestörter Seiltänzergang, fragliche dystone Symptome, diskrete Gedächtnisstörung, Ruhetremor, andere diskrete neurologische Auffälligkeiten. Dabei dürfen diese Symptome nicht so deutlich ausgeprägt genug sein, um eine andere neurologische Syndromdiagnose – etwa Dystonie, Parkinson, Ataxie – stellen zu können. Entstanden ist die neue Kategorie unter der Annahme, dass sich bei solchen Patienten eine andere Erkrankung manifestieren könnte, welche mit einem unspezifischen Aktionstremor als frühe Symptomatik einhergeht.
Eine Studie aus dem Jahr 2018 hat gezeigt, dass mehr als die Hälfte der Patienten in die neue Kategorie EP+ fallen [3]. Wichtig ist, dass es bezüglich der Therapie bislang keine Unterschiede zwischen ET und ET+ gibt.
Empfehlung für Topiramat bei ET
Die etablierten medikamentösen Therapien für den ET sind Propranolol und Primidon. In der Leitlinie wird nun auch Topiramat mit einer Zieldosis von ≥ 200 mg TD in die Empfehlung mit aufgenommen. Der Einsatz von Primidon und Topiramat erfolgt off label. Hintergrund für die Aufnahme von Topiramat in die Therapieempfehlungen sind Evidence-based Reviews der Movement Disorder Society (MDS) sowie eine Cochrane Metaanalyse [4].
Botulinumtoxin bei dystonem Händetremor
Nach aktueller Studienlage zeigt die elektromyographisch gesteuerte Injektion von Botulinumtoxin eine gute Wirksamkeit bei Patienten mit dystonem Händetremor, bei gleichzeitig günstigen Nebenwirkungsprofil. Die Autoren beziehen sich dabei auf eine randomisierte Placebo-kontrollierten Studie mit 30 Patienten [5].
In der Botulinumtoxin-Gruppe zeigte sich eine signifikante Reduktion des Tremors (gemessen mittels Fahn-Tolosa-Marin Tremor Rating Scale [TRS]) und eine Besserung in der Global Impression of Change (PGIC)-Skala. Das Auftreten von Nebenwirkungen in Form von Schmerzen zeigte keinen signifikanten Unterschied zwischen den beiden Gruppen.
Nicht-medikamentöse Therapie des Funktionellen Tremors
Neu ist auch, dass die nicht-medikamentöse Therapie des Funktionellen Tremors mittels einer spezialisierten Physiotherapie als wirksam angeführt wird. Die spezialisierte Physiotherapie sollte eine Aufklärung des Patienten, die Umschulung von Bewegungen und einen langfristigen Fokus auf das Selbstmanagement umfassen. Hintergrund ist ein biopsychosoziales ätiologisches Modell, welches u.a. Krankheitsüberzeugungen und eine fehlgesteuerte Aufmerksamkeit für die betroffene Körperregion adressiert.
In der Leitlinie werden mehrere Studien aufgeführt, die eine spezialisierte Physiotherapie im Vergleich zur Standard-Physiotherapie untersucht haben. Laut den Autoren der Leitlinie lässt die Studienlage zwar noch keine abschließende Beurteilung zu, aber es gebe deutliche Hinweise auf eine Überlegenheit der spezialisierten Physiotherapie im Vergleich zur Standard-Physiotherapie. Ein weiterer Vorteil: Es traten keine Nebenwirkungen auf.
Ultraschall und MRT bei medikamentenresistentem ET
Ein MRT gesteuerter fokussierter Ultraschall (MRgFUS) kann zur läsionellen Therapie bei einseitiger Behandlung eines medikamentenresistenten ET eingesetzt werden. Die Evidenz für die Anwendung bei Patienten mit Parkinson-Tremor ist laut Leitlinie noch nicht ausreichend.
„Die unilaterale fokussierte Ultraschallbehandlung (MRgFUS) sollte Patienten mit medikamentenresistentem essentiellem Tremor angeboten werden, wenn eine einseitige Behandlung aussichtsreich ist und / oder eine Verbesserung der Lebensqualität für den Patienten trotz nur unilateraler Tremorreduktion anzunehmen ist. Die Festlegung der individuellen Indikation bleibt den Spezialzentren vorbehalten. Mit dem MRT gesteuerten fokussierten Ultraschall (MRgFUS) steht eine neue, nicht invasive, läsionelle Therapie zur einseitigen Behandlung des medikamentenresistentem ET und mit bislang ungenügender Evidenz auch des Parkinson-Tremors zur Verfügung“, so lautet Empfehlung in der Leitlinie, mit einer Konsensstärke von 100% [1].
Hintergrund für die Empfehlung ist eine randomisierte Studie, in welcher MRgFUS mit einer Scheinbehandlung verglichen wurde [6].










