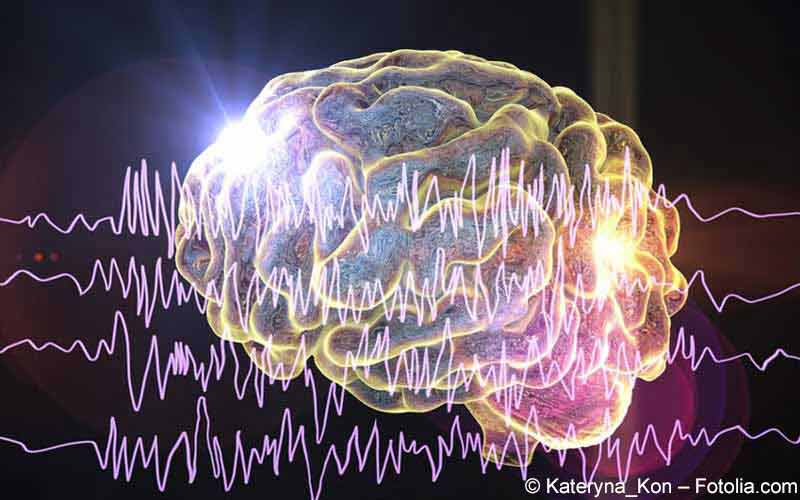
Hintergrund
Epilepsien gehören mit einer Prävalenz von 5-10/1.000 zu den häufigeren chronisch-neurologischen Erkrankungen. Meist ist ein epileptischer Anfall selbstlimitierend. In manchen Fällen kommt es aber vor, dass ein Anfall länger als fünf Minuten dauert. Ein solcher Status epilepticus ist potentiell lebensbedrohlich und muss umgehend therapiert werden.
Die medikamentöse Therapie des Status epilepticus ist in den Leitlinien [1, 2] klar dokumentiert. Es sollten Benzodiazepine (Lorazepam, Midazolam oder Diazepam) i.v. oder rektal verabreicht werden.
Zielsetzung
Wie die Umsetzung dieser Empfehlungen erfolgt, das untersuchte eine Studie, die im Fachjournal „Annals of Neurology“ veröffentlicht wurde [3]. Das Team um Erstautor Priv.-Doz. Dr. Christoph Kellinghaus, Sektionsleitung Allgemeine Neurologie und Epileptologie/Epilepsiezentrum Münster-Osnabrück am Klinikum Osnabrück, untersuchte bei Patienten in Deutschland, Österreich und der Schweiz die medikamentöse Therapie des Status epilepticus (SE) und die Zeitspanne von Therapiebeginn bis Anfallsende.
Methodik
Über einen Zeitraum von viereinhalb Jahren erfolgte die prospektive Sammlung von Daten im sogenannten „SENSE“-Register. SENSE steht für Sustained Effort Network for treatment of Status Epilepticus. Die Patienten, die in die Studie eingingen, wurden entsprechend ihrer Anfallsart in generalisiert-konvulsive SE (GCSE) und nicht-GCSE gruppiert. Als primärer Endpunkt wurde die Zeitdauer bis zur erfolgreichen Unterbrechung des SE (eine Stunde bei GSCE und 12 Stunden bei nicht-GCSE) definiert.
Ergebnisse
Insgesamt gingen die Daten von 1.049 Patienten in die Studie mit ein. Das durchschnittliche Alter betrug ca. 70 Jahre und 43% der Teilnehmenden hatten einen GCSE.
Im Mittel betrug die Zeit vom Beginn des SE bis zur Notfalltherapie bei einem GCSE 30 Minuten und bei einem Nicht-GCSE 150 Minuten. Die Diagnose eines Nicht-GCSE wird oft deutlich verzögert gestellt, so dass die Therapie auch entsprechend später eingeleitet wird.
Bei 86% der Patienten mit GCSE war das erste i.v. applizierte Medikament ein Benzodiazepin, in der nicht-GCSE-Gruppe lag dieser Wert bei 73%. In beiden Gruppen war die Erstdosis niedriger als empfohlen und der SE sistierte bei 16% der Patienten innerhalb von 30 Minuten und bei 51% innerhalb von 12 Stunden. In der GCSE-Gruppe gelang die Anfallsterminierung innerhalb einer Stunde bei 70% der Patienten nicht und in der nicht-GCSE-Gruppe bei 58% nicht, bezogen auf ein Zeitfenster von 12 Stunden.
Fazit
In der Studie wurden die Leitlinienempfehlungen in Bezug auf die medikamentösen Erstmaßnahmen beim SE in einem Großteil der Fälle nicht befolgt. Die Dauer bis zur Anfallsterminierung war davon abhängig, ob Benzodiazepine eingesetzt wurden oder nicht. „Bis zum Eintreffen des Notarztes ist der klassische epileptische Anfall meistens schon vorüber, dann ist keine medikamentöse Intervention mehr erforderlich – im Gegenteil kann dann der Einsatz von Benzodiazepinen zu Problemen führen, die ohne Therapie eigentlich gar nicht aufgetreten wären, wie eine Unterdrückung der Atmung mit nachfolgender Intubations- und Beatmungspflicht“, erklärt Dr. Kellinghaus [4].
Warum die Erstbehandlung nicht gemäß den Leitlinien erfolgte, dazu finden sich in der Studie keine Angaben. „Möglicherweise spiegelt das Ergebnis der Studie die Angst der Erstbehandler wider, durch eine zu hohe Gabe von Benzodiazepinen die Patienten im Status epilepticus in eine Ateminsuffizienz zu bringen“, vermutet Dr. Kellinghaus. In der Studie konnte jedoch bei den meisten Patienten in der Klinik der SE terminiert werden, und Patienten mit hohen Benzodiazepin-Dosen, deren SE in der ersten bzw. den ersten 12 Stunden terminiert wurde, hatten kein erhöhtes Risiko, beatmet werden zu müssen. „Die Sorge vor Ateminsuffizienz sollte also keinesfalls zu einer Untertherapie führen“, so der Experte abschließend.










