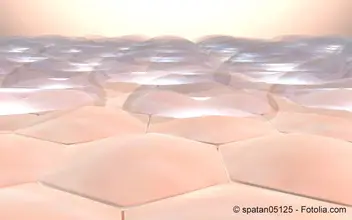Wenn’s mehr als sechs Wochen juckt, spricht man von chronischem Pruritus (CP). Und der ist gar nicht so selten: Laut der neue S2k-Leitlinie leiden derzeit 13%−17% der Allgemeinbevölkerung unter anhaltendem Juckreiz. Nur die Hälfte von ihnen erhält eine kontinuierliche ärztliche Betreuung und nur sieben Prozent eine Therapie.
CP – große Krankheitslast
CP ist jedoch keine Bagatelle, denn er geht mit erheblichem subjektivem Leiden einher: der Juck-Kratz-Zyklus führt primär zu Blutungen, Krusten und Narben. Zudem leiden die Betroffenen an Schlafstörungen, Ängsten, Depressivität, niedrigem Selbstwertgefühl. Die Folgen können sozialer Rückzug, Depression oder sogar Suizidalität sein.
Auch bei Niereninsuffizienz juckt’s
Die Ursachen für CP sind vielfältig: Juckreiz tritt nicht nur bei chronischen Hauterkrankungen wie Psoriasis oder Atopischer Dermatitis auf, sondern ist auch häufig Leitsymptom internistischer Erkrankungen wie Niereninsuffizienz oder Diabetes mellitus.
Breites Spektrum an Fachdisziplinen
Auch wenn das Symptom CP häufig ist, fühlen sich viele Ärzte in Sachen CP-Therapie oft hilflos. Hier will die neue Leitlinie, die federführend von der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft (DDG) unter Leitung von Professor Dr. Sonja Ständer (Münster) erarbeitet wurde, Abhilfe schaffen. Dabei richtet sich die neue Leitlinie nicht nur an die Arztgruppen, die als erste von den Patienten aufgesucht werden wie Dermatologen, Allgemeinmediziner, Internisten, Gynäkologen oder Psychosomatiker. Auch Vertreter von weiteren Fachdisziplinen – beispielsweise Allergologie, Nephrologie, Hämatologie oder Gastroenterologie – können aus dem 115 Seiten umfassenden Werk Diagnose- und Therapieempfehlungen entnehmen.
Drei Säulen der Therapie
Bei allen Formen von CP bedarf es einer gezielten Versorgung der Patienten, wobei die Therapieempfehlungen auf drei Säulen beruhen:
- Symptomatisch-antipruritische Therapie
- Interdisziplinäre Diagnostik und Therapie der auslösenden Grunderkrankung
- Therapie der sekundären Folgesymptome des Pruritus (Dermatologische Therapie, Schlafförderung, bei einer begleitenden oder zugrundeliegenden psychischen oder psychosomatischen Erkrankung eine entsprechende psychologisch-psychotherapeutische Behandlung)
Übersichtliche Tabellen zu Therapieempfehlungen
Ständer weist darauf hin, dass es keine allgemeingültige, einheitliche Therapie von CP existiert, da es eine hohe Diversität der möglichen zugrundeliegenden Ursachen und der unterschiedlichen Patientenkollektive besteht. Es sollten also individuelle Therapiepläne erstellt werden. In der Leitlinie geben die Tabellen 12-19 einen Überblick über evidenzbasierte, symptomatische Therapieempfehlungen, die aus Phototherapie, topischen und systemischen Medikamenten bestehen.