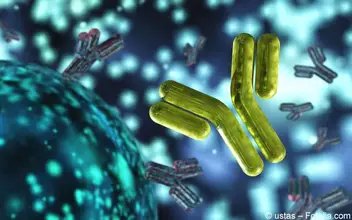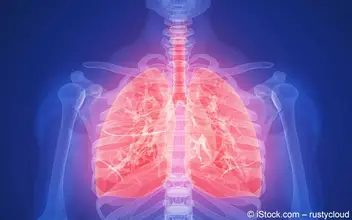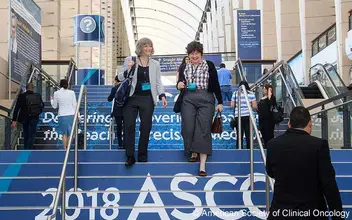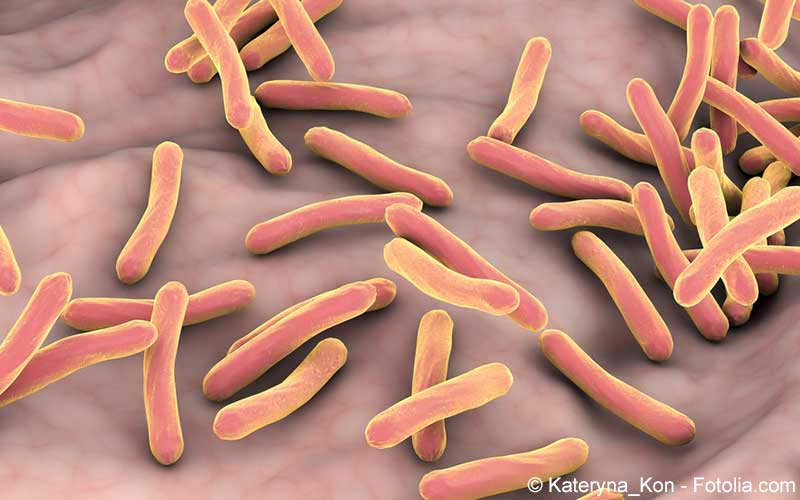
Schon früh zeigte sich im Mausmodell, dass die CTLA4-Blockade zu einer Dysbiose des Darmmikrobioms führt, die Auswirkungen über den Darm hinaus hat: Es kam zu einer Verlagerung von Bakterien, einer Stimulation von dendritischen Zellen und einem Interleukin-12-abhängigen Priming von T-Zellen. Bei der Programmed-Death-Ligand-1-(PD-L1)-Blockade zeigte sich zwar keine Dysbiose, aber auch ein Effekt auf antigenpräsentierende Zellen, wie Dr. Nathalie Chaput-Gras vom Institute Gustave Roussy, Villejuif, Frankreich, anlässlich des ESMO 2018 in München berichtete [1].
Erfolg der Ipilimumab-Therapie abhängig von Mikrobiom
Bei entsprechenden Analysen bei Patienten mit einem Malignen Melanom (MM), die den CTLA4-Hemmer Ipilimumab erhielten, fand sich eine Assoziation von bestimmten Bakterien mit dem Grad, in dem Patienten von der Therapie mit Ipilimumab profitierten. Ein besseres Gesamtüberleben und progressionsfreies Überleben zeigte sich bei einem Überwiegen von Faecalibacterium und anderen Formicute-Bakterien. Eine hohe Abundanz des Bacteroides-Clusters war mit einer schlechteren Prognose assoziiert.
Mikrobiom kann Nebenwirkungen begünstigen oder vermeiden helfen
Zudem war die Zusammensetzung des Mikrobioms auch mit dem Auftreten einer Kolitis als Nebenwirkung der Therapie assoziiert: Eine hohe Abundanz von Bakterien des Genus Firmicutes war mit dem Auftreten einer Kolitis, von Bakterien der Gattung Bacteroides mit dem Ausbleiben einer Kolitis assoziiert.
PD-L1-Blockade wird durch Darmflora moduliert
Verschieden Autoren belegten in der Folge, dass Darmmikrobiota auch den Effekt der PD-L1-Blockade beim MM modulieren. Bei anderen Tumoren fanden sich ebenfalls solche Assoziationen, hier spielten aber andere Bakterien eine vorherrschende Rolle. Vor allem ließen sich die auf Ebene von Bakterienstämmen gefunden Assoziationen nicht auf einzelne Arten herunterbrechen.
„Es gibt nicht ein Bakterium, das der Superheld ist“, betonte Chaput-Gras. Die gezielte Beeinflussung des Darmmikrobioms mit einem Probiotikum ist also nicht erfolgversprechend, die Zusammenhänge sind komplexer.
Gute und schlechte Mikrobiota
Es ist aber inzwischen gut belegt, dass das Darmmikrobiom systemische Effekte erzielen kann, erläuterte Chaput-Gras:
- „Gute“ Mikrobiota gehen mit weniger regulatorischen T-Zellen und myeloischen Stammzellen einher. Diese Patienten könnten die adaptive Immunantwort unter der Immuncheckpointblockade besser reaktivieren.
- „Gute“ Mikrobiota sind assoziiert mit weniger systemischer Inflammation, wie bei vielen Erkrankungen gezeigt. Die Spiegel von Interleukin(IL)-6, IL8 und Serum-CD25 im Blut sind vor Therapie niedriger.
- „Gute“ Mikrobiota sind assoziiert mit einer bessern Aktivierung von T-Zellen während der Immuntherapie.
- „Gute“ Mikrobiota sind assoziiert mit einer höheren CD8+-T-Zell-Infiltration in Tumoren.
Die Expertin geht davon aus, dass die Mediatoren dieser Effekte Metaboliten sind, die in das Blut übertreten, in Lymphknoten und Tumoren ihre Wirkungen entfalten und nicht nur die Wirksamkeit, sondern auch Nebenwirkungen modulieren.