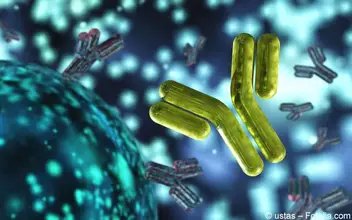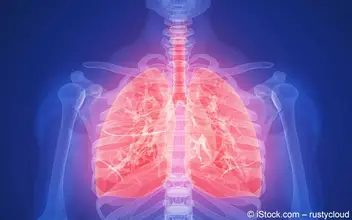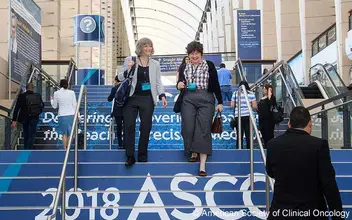Die Immuntherapie entwickelt sich zu einer potenziellen therapeutischen Option für Patienten Kopf-Hals-Plattenepithelkarzinomen. Abgesehen vom HPV-Status existieren derzeit keine validierten Biomarker für die Auswahl oder Stratifizierung von Patienten mit Kopf-Hals-Plattenepithelkarzinomen, die eine Immuntherapien erhalten könnten. Bisher hat sich die Untersuchung von genomischen Veränderungen von Kopf-Hals-Plattenepithelkarzinomen nur als eingeschränkt hilfreich erwiesen. Bei Tumoren der Speicheldrüsen gibt es positive Ansätze. Prof. Ben Solomon vom Peter MacCallum Cancer Centre in Melbourne, Australien, erläuterte auf dem ESMO 2018 in München aktuelle Entwicklungen bei der Suche nach geeigneten Biomarkern [1].
Einziger validierter Biomarker beim Oropharynxkarzinom
Der Nachweis auf HPV (humanes Papillomavirus) ist derzeit der einzige validierte Biomarker.
Das HPV ist von ätiologischer Bedeutung für die Entwicklung von oralen Plattenepithelkarzinomen. Es führt zur Überexpression von p16. Unabhängig von den Behandlungsmodalitäten dient die p16-Immunhistochemie (IHC) bzw. die RNA In-situ-Hybridisierung (ISH) beim Oropharynxkarzinom als prognostische Marker.
Typischerweise treten bei Kopf-Hals-Tumoren wiederholt Mutationen und Kopienzahlvariationen auf. HPV-positive und HPV-negative Tumoren unterscheiden sich deutlich im Genom. Dies stellt eine Herausforderung bei der Identifizierung als Biomarker geeigneter genomischer Veränderungen dar.
Biomarker in der Evaluierung
Die EGFR-Kopienzahl hat sich in der EXTREME-Studie als nicht prädiktiv für die Wirksamkeit von Cetuximab plus Platin / 5-FU als Erstlinientherapie bei Patienten mit rezidivierendem und / oder metastasiertem Plattenepithelkarzinom des Kopfes und Halses gezeigt.
RAS-Mutationen scheinen in einigen Fällen mit einer Resistenz für Cetuximab zu korrelieren.
Für den Fibroblast growth factor receptor 1 (FGFR1) konnte kein Zusammenhang zwischen Amplifikation und erhöhter Plasmaexpression der RNA beobachtet werden.
HRAS-Mutationen werden in HPV-negativen Tumoren beobachtet, jedoch ist die Häufigkeit der Tumoren und der Mutationsrate gering. Es wurde über erfolgreiche Therapien mit dem Farnesyltransferase-Inhibitor Tipifarnib berichtet.
Speicheldrüsentumoren
Speicheldrüsentumoren weisen eine große genomische Heterogenität auf. Eine Amplifikation des Her2-Gens wird in 35% der Tumoren beobachtet. Für duktale Formen wurde eine erhöhte Mutationslast festgestellt. Der Androgenrezeptor wird überexprimiert.
Dadurch wird der Tumor über eine Blockade des Androgenrezeptors therapeutisch zugänglich.
Schilddrüsenkarzinome
Bei diesem häufigsten Tumor der endokrinen Organe finden sich ansprechbare Mutation in 37% aller Patienten. Dabei unterscheiden sich die therapeutischen Angriffspunkte je nach Subtyp des Tumors.
Häufig enthalten diese Tumoren Mutationen im BRAF-Gen und sprechen gut auf Dabrafenib und Kombinationen von Dabrafenib mit Trametinib an.
In 20% aller Patienten mit differenziertem Schilddrüsenkarzinom finden sich RET/PTC-Umlagerungen. Bei RET-Fusions-positiven Tumoren beobachtet man eine gute Wirksamkeit von Loxo292. Tumoren konnten bis zu 40% ihrer Grüße reduziert werden. Bei medullären Tumoren scheint die Wirksamkeit etwas niedriger.
Nasopharynxkarzinom
Beim Nasopharynxkarzinom finden sich häufig Veränderungen beim Chromatin-modifizierenden Enzymen.
Als vielversprechender Biomarker zeigt sich die vom Tumor abgeleitete EBV (Epstein-Barr-Virus)-DNA, die sich per PCR detektieren lässt und sowohl für die Diagnose als auch für die Kontrolle des Therapieansprechens eingesetzt werden kann. Studien belegen auch die Eignung von EBV als prognostischer Marker und für die Therapieentscheidung. Weiterhin berichtet eine Studie über den Nutzen von EBV-DNA bei der Früherkennung des nasopharyngealen Karzinoms.