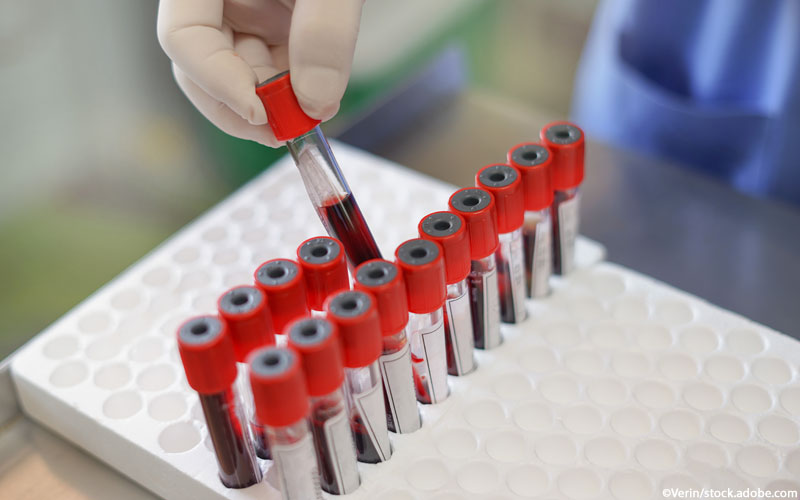
Wie hoch müssen Antikörpertiter sein, damit man nach einer Corona-Impfung vor einer COVID-19-Infektion geschützt ist? Diese Frage ist derzeit Gegenstand vieler Diskussionen.
Bislang gibt es keinen festgelegten Grenzwert, anhand dessen die Schutzwirkung abgelesen werden kann. Demnach gibt es auch keinen Index, der angibt, ab wann die Immunantwort nicht mehr ausreicht, um nach einer SARS-CoV-2-Infektion an COVID-19 zu erkranken.
Diese Information wäre aber gerade im Hinblick der Dritt- bzw. Auffrischungsimpfungen von Interesse. Forscher von der Universität Oxford haben aktuell Grenzwerte als Immunkorrelat vorgestellt; die Ergebnisse ihrer Studie sind im Fachmagazin Nature Medicine nachzulesen [1].
Zielsetzung
Um die Entwicklung von Impfstoffen zu beschleunigen, sind Kenntnisse über den Zusammenhang zwischen Immunreaktionen auf Impfstoffe und der nachfolgenden Schutzwirkung erforderlich. Das Wissen um Grenzwerte, die statistisch mit dem Schutz vor einer Krankheit assoziiert sind (sogenannte Immunkorrelate), würde die Zulassung von neuen Vakzinen allein auf der Grundlage von Immunogenitäts- und Sicherheitsdaten erlauben, wenn große Wirksamkeitsstudien nicht durchführbar sind.
Zudem bilden definierte Grenzwerte eine Evidenzbasis für Impfempfehlungen, etwa bei Booster-Impfungen. Vor diesem Hintergrund ermittelte ein Wissenschaftsteam um Dr. Shuo Feng von der Universität Oxford in einer Fortführung der Zulassungsstudie von Vaxzevria, wie hoch die Antikörperspiegel nach der Grundimmunisierung sein müssen, um wirksam eine COVID-19-Infektion zu verhindern.
Methodik
Die Forscher untersuchten die Antikörpertiter von Personen, die zweimal mit dem COVID-19-Impfstoff von AstraZeneca geimpft wurden. Genauer ermittelten sie die bindenden und neutralisierenden Antikörper 28 Tage nach der zweiten Dosis bei infizierten und nicht-infizierten Impfstoffempfängern. Zum Wirksamkeitsnachweis der Impfung wurden die Schwellenwerte für vier Immunmarker (Anti-Spike-IgG, IgG-Antikörper gegen die Rezeptor-Bindungsdomäne [RBD], Pseudovirus-Neutralisierung und Corona-Lebendvirus-Neutralisierung) ermittelt, die mit dem Schutz vor einer symptomatischen Infektion in Verbindung stehen.
Ergebnisse
Unter den 4.372 Teilnehmern in der Korrelatspopulation gab es insgesamt 174 Durchbruchsfälle einer SARS-CoV-2-Infektion. Im Ergebnis waren höhere Werte aller Immunmarker mit einem geringeren Risiko für eine symptomatische COVID-19-Erkrankung assoziiert.
Eine 80-prozentige Schutzwirkung gegen eine symptomatische Infektion mit der Alpha-Variante von SARS-CoV-2 werde mit 264 bindenden Antikörpereinheiten (BAU)/ml von gegen das Spike-Protein von SARS-CoV-2 gerichteten IgG-Antikörpern und 506 BAU/ml für Anti-RBD-Antikörper erzielt, so die Studienautoren.
Mit dem Auftreten von asymptomatischen Infektionen korrelierten die Immunmarker indes nicht (Signifikanzniveau 5%).
Einschränkungen
Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass es für keinen der untersuchten Immunmarker einen definitiven Schwellenwert gibt, der auf eine sichere Immunität hindeutet. Eine verringerte Infektionswahrscheinlichkeit liegt im Durchschnitt aber bei einer höheren Immunreaktion vor. Die einzelnen Immunkorrelate könnten je nach Altersstruktur variieren. Dies war in der vorliegenden Studie aufgrund der geringen Anzahl älterer Erwachsener nicht überprüfbar.
Die ermittelten Antikörperspiegel bilden lediglich einen punktuellen Zustand ab, und zwar exakt 28 Tage nach der zweiten Impfstoffdosis. Dieser soll in den folgenden vier bis sechs Monaten die Wirksamkeit und Immunogenität gewährleisten. Für Angaben zur Dauerhaftigkeit der Antikörper und des Langzeitschutzes nach der Impfung werden weitere Untersuchungen benötigt.
Ein anderes Problem sind die großen Konfidenzintervalle bei sehr niedrigen oder sehr hohen Titern, etwa ein 95%-KI von 108–806 bei den Anti-Spike-IgG-Werten. Für eine genauere Schätzung sind weitere Studien mit größeren Populationen erforderlich.
Die Studie bezieht sich nur auf den Impfstoff von AstraZeneca und die zum Studienzeitpunkt vorherrschende Alpha-Variante. Die derzeit mehrheitlich kursierende Delta-Variante ist jedoch rund 50 Prozent ansteckender. Darüber hinaus verwenden andere Impfstoffhersteller andere Impfstofftechnologien. Das Verhältnis zwischen Antikörper- und T-Zell-Reaktionen kann je nach Art des verwendeten Impfstoffs unterschiedlich ausfallen. Die Ergebnisse können somit nicht auf alle zugelassenen COVID-19-Vakzine und nicht auf alle Virus-Varianten übertragen werden.
Fazit
Trotz der Einschränkungen bietet die Studie eine gute Diskussionsgrundlage. Die Immunkorrelate können verwendet werden, um mithilfe validierter Assays eine Brücke zu neuen Populationen und neuen Impfstoffen zu schlagen. Ferner können Daten zur Extrapolation von Wirksamkeitsschätzungen für neue Impfstoffe verwendet werden, die ähnliche Immunmechanismen nutzen und für die keine Wirksamkeitsdaten verfügbar sind.














