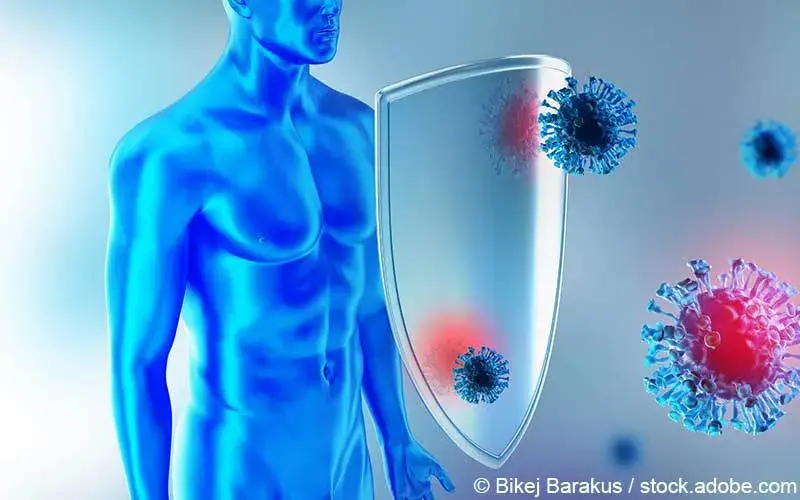
Die Kenntnis darüber, wie lange und stark eine frühere SARS-CoV-2-Infektion vor einer späteren Reinfektion, einer symptomatischen Covid-19-Erkrankung oder einem schweren Krankheitsverlauf schützt, ist für die Vorhersage der künftigen potenziellen Krankheitslast und die Entscheidung über den Zeitpunkt der nächsten Corona-Impfung von zentraler Bedeutung. Diese Fragen haben Forschende in der bislang größten Metaanalyse zur Immunität nach einer Corona-Infektion beleuchtet.
Eine Arbeitsgruppe um Dr. Caroline Stein vom Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) an der University of Washington School of Medicine, Seattle, wertete 65 Studien aus 19 verschiedenen Ländern aus. Berücksichtigt wurden die natürliche Immunität nach Infektionen mit unterschiedlichen SARS-CoV-2-Varianten und der Schutz einer Corona-Impfung. Die Ergebnisse wurden im Fachmagazin „The Lancet“ publiziert [1].
Prä-Omikron-Varianten schützen gut vor Reinfektion und symptomatischem Krankheitsverlauf
Nach Auswertung aller Daten bieten alle Prä-Omikron-Varianten (Wildtyp, Alpha, Beta und Delta) eine gute Protektion vor einer Reinfektion. Den Forschenden zufolge lag der erzielte Schutz mit dem Wildtyp sowie den Varianten Alpha und Delta nach einem Monat bei 85,2%. Selbst nach zehn Monaten waren Genesene nach einer Infektion mit diesen Varianten noch zu 78,6% geschützt. Danach sank der Immunschutz und lag nach 20 Monaten noch bei 55,5%.
Überdies reduzierte eine Prä-Omikron-Infektion das Risiko für eine erneute symptomatische Covid-19-Erkrankung deutlich. Der erzielte Schutz entsprach in etwa den Schätzungen für eine Reinfektion.
Vor einer symptomatischen Erkrankung durch den Wildtyp sowie die Varianten Alpha und Delta schützte eine Prä-Omikron-Infektion zu 78,4% nach zehn Monaten. Eine symptomatische Erkrankung durch Omikron BA.1 wurde hingegen nur zu 37,7% verhindert.
Geringer Immunschutz nach BA.1-Infektion
Den Ergebnissen zufolge schützt die Omikron-Subvariante BA.1 deutlich schlechter vor einer Reinfektion mit BA.1 (45,3%); nach zehn Monaten lag der Effekt nur noch bei 36,1%. Vor einem symptomatischen Covid-19-Verlauf waren die BA.1.-Genesenen zu 44% geschützt.
Schutz vor schwerer Erkrankung variantenunabhängig hoch
Vor schweren Covid-19-Verläufen sind Genesene unabhängig von der Variante stark und langanhaltend geschützt. Für den Wildtyp sowie Alpha und Omega lag die Schutzwirkung selbst nach zehn Monaten bei 90,2% und für BA.1 bei 88,9%. Insgesamt war das Risiko für einen Krankenhausaufenthalt oder Tod nach einer Infektion für mindestens zehn Monate um 88% reduziert, verglichen mit SARS-CoV-2-naiven Personen.
Der Schutz vor den Omikron-Subvarianten BA.2, BA.4 und BA.5 wurde nur in sechs Studien untersucht. Diese deuten auf einen signifikant reduzierten Schutz hin, wenn die Erstinfektion mit einer Prä-Omikron-Variante erfolgte. Bei einer Erstinfektion mit Omikron blieb der protektive Effekt hingegen auf einem hohen Niveau.
SARS-CoV-2-Infektion und Coronaimpfung schützen gleichwertig
Den Forschenden zufolge schützt eine Infektion mindestens so gut und so lange vor einer Reinfektion, einer symptomatischen Erkrankung und einem schweren Verlauf wie zwei Dosen mit einem der beiden mRNA-Vakzine (Moderna, BioNTech/Pfizer). Dies gilt sowohl für die Ursprungs-, Alpha- und Delta-Varianten als auch für die Omikron-Sublinie BA.1.
Auswirkungen von Infektionen mit Omikron XBB und seinen Untergruppen wurden in der Datenanalyse nicht erfasst.
Impfung bleibt der sicherste Weg
Die Forschenden warnen davor, auf Basis ihrer Ergebnisse von einer Impfung gegen Covid-19 abzuraten. „Eine Impfung ist der sicherste Weg, um sich vor einer Covid-19-Erkrankung zu schützen. Bei der natürlichen Immunität muss der dadurch gewonnene Schutz gegen die Risiken einer schweren Erkrankung und Tod durch die Erstinfektion abgewogen werden“, erklärte Seniorautor Prof. Stephen Lim vom IHME.
„Impfstoffe sind weiterhin für alle wichtig, um Hochrisikogruppen wie Menschen über 60 Jahre und Menschen mit Begleiterkrankungen zu schützen“, ergänzt Stein. „Entscheidungsträger sollten sowohl die natürliche Immunität als auch den Impfstatus berücksichtigen, um ein vollständiges Bild des Immunitätsprofils einer Person zu erhalten.“
Weitere Forschungsarbeiten erforderlich
Der schwächere variantenübergreifende Immunschutz vor der Omikron-Variante und ihren Untergruppen sei auf deren Mutationen zurückzuführen, mit denen sie eine aufgebaute Immunität leichter unterlaufen als andere Varianten, sagt Mitautor Dr. Hasan Nassereldine, ebenfalls vom IHME.
Er fügt hinzu, „dass die begrenzten Daten, die zum natürlichen Immunschutz durch die Omikron-Variante und ihren Untergruppen vorliegen, die Bedeutung unterstreichen, Infektionen durch verschiedene Varianten weiter zu verfolgen – zumal sich mit dieser Variante zwischen November 2021 und Juni 2022 schätzungsweise 46% der Weltbevölkerung infiziert hätten“.
Ebenso sind weitere Forschungsarbeiten erforderlich, um „die natürliche Immunität neu auftretender Varianten zu bewerten und den Schutz zu untersuchen, der durch eine Kombination von Impfung und natürlicher Infektion entsteht“, sagt Nassereldine.














