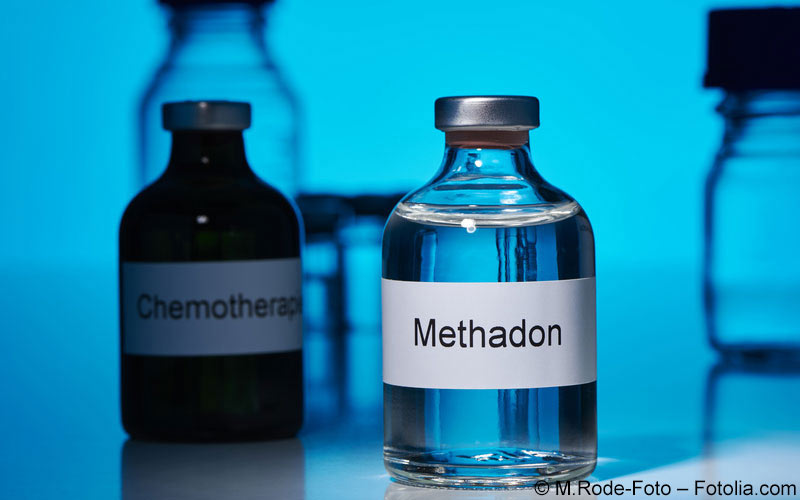
Methadon galt in den letzten Jahren für viele Patienten als Hoffnungsträger in der Therapie von Glioblastomen. Immer wieder gab es Medienberichte, in denen über spektakuläre Heilungen von Hirntumoren mit Methadon berichtet wurde. Das Opioid sollte einer Ulmer Forscherin zufolge wahre Wunder bei austherapierten Krebspatienten bewirken. Allerdings gab es bislang keinerlei gesicherte evidenzbasierte Erkenntnisse, die einen antitumoralen Effekt des μ-Opioid-Rezeptor-Agonisten bestätigen konnten.
Auf dem 33. Deutschen Krebskongress in Berlin stellten Wissenschaftler des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) nun aktuelle Forschungsergebnisse von experimentellen Zellkultur-Untersuchungen mit Methadon vor. Die Ergebnisse fielen leider ernüchternd aus. Den Studienergebnissen zufolge gibt es keinerlei Hinweise, dass Methadon die Wirkung einer Chemotherapie bei Glioblastomen verstärkt.
Studienergebnisse zeigen Wirkungslosigkeit von Methadon
Neue Forschungsergebnisse zeigen nachweislich die Wirkungslosigkeit von Methadon bei Glioblastomen. Für die Studie behandelten Wissenschaftler im Labor Glioblastom-Zellkulturen. Verglichen wurden die Therapieerfolge mit dem Chemotherapeutikum Temozolomid als Monotherapie und Methadon als Monotherapie sowie einer Kombinationsbehandlung aus Temozolomid und Methadon. Als Kontrolle dienten unbehandelte Zellkulturverbände. „Leider mussten wir feststellen, dass Methadon die Wirksamkeit der Chemotherapie nicht verstärkt. Das Opioid hat keinerlei sensibilisierende Wirksamkeit für die bei Glioblastomen eingesetzte Standardtherapie mit Temozolomid. Auch Methadon allein hat keinen nachweisbaren Effekt auf das Überleben oder Sterben der Krebszellen“, erklärt Prof. Dr. Wolfgang Wick, Direktor der Neurologischen Klinik & Nationales Centrum für Tumorerkrankungen am Universitätsklinikum Heidelberg.
Keine Methadon-Rezeptoren an Gliomzellen
Eine mögliche Erklärung für die Wirkungslosigkeit von Methadon bei Gliomzellen sehen die Forscher in den Glioblastomzellen selbst. Diese besitzen in der überwiegenden Mehrzahl keine Opioidrezeptoren. Ohne diesen Rezeptor kann Methadon an der Tumorzelle jedoch keine antitumorale Wirkung entfalten. „In der aktuellen Studie ist mit Zellen gearbeitet worden, die der Situation beim Patienten ähnlich sind,“ so Prof. Dr. Uwe Schlegel, Direktor der Klinik für Neurologie am Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus Bochum. „Sie besitzen ebenso wie reale Glioblastome im Menschen keine Opioidrezeptoren und können leider deshalb gar nicht auf Methadon ansprechen.“
So wurde Methadon zum Hoffnungsträger
2017 sorgte ein Bericht der Sendung Stern TV für großen Wirbel - gleichzeitig aber auch für Hoffnung und Verunsicherung bei Patienten mit schwer therapierbaren Hirntumoren. In der Sendung wurde von mehreren Patienten berichtet, die dank Methadon scheinbar ihre bereits austherapierte Krebserkrankung überlebt haben. Hintergrund dieser Erfolgsmeldungen waren Forschungsergebnisse der Ulmer Chemikerin Dr. Claudia Friesen. Friesen ist seit mehr als 20 Jahren in der Krebsforschung tätig. Sie behauptet, dass Krebszellen absterben, wenn eine Chemotherapie mit Methadon kombiniert wird. Mit Aussagen wie in der ARD-Sendung „Plusminus“: „Gebe ich Methadon dazu, kann ich einen hundertprozentigen Zelltod erreichen,“ weckte Friesen bei vielen Tumorpatienten große Hoffnungen. Dabei gibt es bislang keine evidenzbasierten Fälle und keine klinischen Studien für ihre Behauptungen. Friesens Erkenntnisse stützen sich ausschließlich auf vorklinische Experimente mit Zellkulturen oder tierexperimentelle Studien.
Heilungs-Aussagen werden angezweifelt
Viele Mediziner und Fachgesellschaften zweifeln Friesens Fallbeispiele an. Auch das Uniklinikum Ulm distanziert sich von den heilungsversprechenden Aussagen der Chemikerin. In einer Stellungnahme heißt es: „Wir halten den unkritischen Einsatz von Methadon außerhalb klinischer Studien für nicht gerechtfertigt. Der unkontrollierte Einsatz weckt bei Patienten unrealistische Erwartungen, die sich nachteilig für die Patienten auswirken können.“ Wick als Leiter der Neuroonkologischen Arbeitsgemeinschaft hält die Ergebnisse ebenfalls für unzureichend, da sie lediglich auf experimentellen Erkenntnissen beruhen. Er erläutert: „Experimentell bedeutet, dass es für die Anwendung keine erforderliche Datenbasis gibt, aufgrund derer unsere Zulassungsbehörden – das ist ja national und international ganz gut geregelt – eine Zulassung für die Behandlung von Patienten mit Hirntumoren besteht."
Keine supportive Methadon-Therapie bei Glioblastomen empfohlen
Da Methadon den aktuellen Studienergebnissen keinerlei Nutzen in Verbindung mit einer Chemotherapie bei Glioblastomen zeigt, kann die Methadon-Hypothese als widerlegt angesehen werden. Es gibt keine wissenschaftliche Grundlage, Methadon in der Glioblastom-Therapie einzusetzen. „Außerhalb von klinischen Studien ist von einer supportiven Methadon-Therapie des Glioblastoms dringend abzuraten“, betont auch Schlegel.
Ob Methadon auf andere Tumorentitäten oder in Verbindung mit anderen Chemotherapeutika wirkt, bleibt aber offen. Dazu sind weitere klinische Studien erforderlich.














