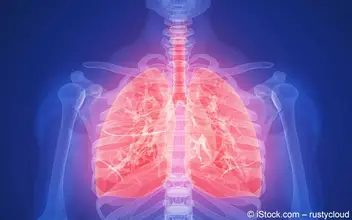Hintergrund
Als im Dezember 2019 die ersten Nachrichten aus China über ein neues Virus nach Europa kamen, konnte niemand ahnen, welche Pandemie die Welt in den folgenden Monaten überrollen würde. Da es sich bei SARS-CoV-2 um ein neues Virus handelte, die Erkrankung COVID-19 völlig unerwartete Krankheitsbilder verursachte und allein das exponentielle Wachstum der Patientenzahlen die Gesundheitssysteme vieler Länder überforderte, agierten Ärzte, medizinisches Personal und Krankenhäuser anfangs ohne klare Richtlinien.
Erfahrungen aus der Intensivstation
Mittlerweile hat man viel dazugelernt. Auch wenn man noch weit davon entfernt ist, das Virus und die Erkrankung völlig zu verstehen, ist es doch an der Zeit, Erfahrungen zu bündeln und zu analysieren. Auf dem virtuellen ERS Kongress 2020 präsentierte Professor Dr. Alexandre Demoule, Leiter der Intensivstation und der Respiratorischen Abteilung des La Pitié-Salpêtrière Hospitals der Sorbonne Universität Paris Daten zu COVID-19-Patienten in Intensivbehandlung [1] und Professor Dr. Stefano Nava, Leiter der Scuola di Specializzazione Malattie dell'Apparato Respiratorio an der Universität Bologna[2] über das Risiko einer Virustransmission auf das medizinische Personal bei nichtinvasiver Beatmung.
Welche Patienten kommen auf Intensivstation?
Es ist keine Neuigkeit, dass vor allem ältere Männer schwere COVID-19-Erkrankungen durchmachen, die intensiv behandelt werden müssen und auch beatmungspflichtig sein können. Je nach Studie waren 65-85% der COVID-19-Patienten auf Intensivstation Männer. Das Durchschnittsalter der Intensivpatienten lag in Italien im Durchschnitt bei 63 (56-70) Jahren, in den USA bei 61 61 ±15 Jahren. „Die Hochbetagten kamen aufgrund ihrer schlechten Prognose häufig nicht in Intensivbehandlung,“ erklärte Demoule das angesichts der Risikoaltersgruppe für schwere Erkrankungen relativ niedrige Durchschnittsalter der Intensivpatienten.
Komorbiditäten als Risikofaktoren
Rund ein Fünftel (20-22%) der Intensivpatienten wies keine Komorbiditäten auf. Die anderen Patienten litten unter einer oder mehreren der folgenden Komorbiditäten:
- Adipositas und Übergewicht 75-85%
- Bluthochdruck 50-60%
- Kardiomyopathie 21%
- Koronare Herzkrankheit 13%
- Typ 2 Diabetes 17-25%
- Nierenerkrankung 2-12%
- Tumoren 5-8%
- COPD 4-8 %
Auffällig ist der hohe Anteil von Patienten mit Übergewicht oder Adipositas, im Vergleich zum unerwartet geringen Anteil der COPD-Patienten, die man anfangs zu den Hauptrisikogruppen zählte. „Allerdings hatten die COPD-Patienten, die auf Intensivstation behandelt und beatmet werden, mussten ein sehr schlechte Prognose“, ergänzte Demoule diese Beobachtung.
COVID-19 Phänotypen nach Demoule
Demoule unterschied in seinem Vortrag grob zwei Phänotypen der schwer erkrankten beatmungspflichtigen COVID-19 Patienten:
- Phänotyp 1 zeichnete sich durch eine geringe Lungenelastizität, ein niedriges Ventilations-Perfusions-Verhältnis, ein geringes Lungengewicht und ein geringes Rekrutierungspotential aus. Phänotyp 1 sprach außerdem kaum auf die Bauchlage bei der Beatmung an.
- Phänotyp 2 hingegen zeigte bei allem Parameter genau das Gegenteil: eine große Lungenelastizität, ein hohes Ventilations-Perfusions-Verhältnis, ein hohes Lungengewicht und ein hohes Rekrutierungspotential aus. Phänotyp 2 sprach außerdem gut auf die Bauchlage bei der Beatmung an.
Viele Faktoren beeinflussten die Sterblichkeit
Die Sterblichkeitsrate stieg erwartungsgemäß mit dem Schweregrad der Erkrankung, variierte aber von Studie zu Studie erheblich. „Bei der hohen Variabilität wird vor allem auch deutlich, wie abhängig die Sterblichkeitsrate von krankheitsunabhängigen Faktoren war“, ordnete Demoule das heterogene statistische Bild ein.
Zu den krankheitsunabhängigen Faktoren gehörten beispielsweise:
- Anzahl der Intensivbetten
- Anzahl der Beatmungsplätze auf den Intensivstationen
- Ausstattung der Intensivstationen
- Personalschlüssel pro Patient
Zu den Patientenabhängigen prognostischen Faktoren zählten:
- Das Alter der Patienten
- Koronare Herzkrankheit und COPD (starke Einflüsse)
- BMI (schwacher Einfluss)
- Diabetes und Krebs (variabler Einfluss)
Kein Einfluss auf die Prognose hatten Bluthochdruck, ACE-Inhibitoren, Angiotensin-II-Rezeptoren Blocker (ARB), Diuretika oder Statine.
Risiken für das medizinische Personal
Als eines der von COVID-19 am stärksten betroffenen europäischen Länder hatte Italien auch hohe Verluste bei Ärzten und medizinischem Personal zu beklagen. Insgesamt wurden 169 Todesfälle durch COVID-19 in den medizinischen Berufen dokumentiert. Den höchsten Anteil der Todesfälle stellten mit 47% die Allgemeinärzte in den Praxen. Um Infektionsrisiken von Ärzten und medizinischem Personal zu erkennen und möglichst auszuschalten wurde, unter anderem von Franco et al. eine Studie zu den Risiken der Virustransmission bei nicht-invasiven Beatmungstechniken erstellt, die Nava in seinem Vortrag vorstellte. [3]
Virustransmission bei nicht-invasiver Beatmung
Die Beobachtungsstudie wurde in den pulmonologischen Abteilungen von neun Krankenhäusern durchgeführt, in denen insgesamt 670 Patienten mit verifizierter Erkrankung an COVID-19 nicht-invasive beatmet wurden. Innerhalb des Beobachtungszeitraums von etwa sechs Wochen infizierten sich 11,4% (n=42) von 369 Angehörigen des medizinischen Personals (inklusive Ärzte) mit SARS-CoV-2. Davon erkrankten 9 Personen milde und 3 benötigten stationäre Behandlung.
Empfehlungen der WHO
Um das Infektionsrisiko bei der Behandlung von COVID-19 Patienten zu senken, verwies Nava auf die WHO Empfehlungen zum Management von schwerkranken Patienten mit COVID-19-Verdacht.[4] Als Beispiel zitierte er die Empfehlungen der WHO zur Unterbringung der Patienten: „Patienten sollten in einem Isolationszimmer mit negativem Druck (mindestens 12 Luftwechsel pro Stunde), einem eigenen Badezimmer und wenn möglich einem Vorraum untergebracht werden. Wenn Räume mit Negativdruck nicht zur Verfügung stehen, sollten Räume gewählt werden, die eine natürliche Ventilation mit einem Luftstrom von mindestens 160 L/s (L=Luftnorm pro Person) aufweisen.“ Dies sei, so Nava, bereits durch einfachen Durchzug (Fenster und Tür auf!) im Krankenzimmer zu erreichen.