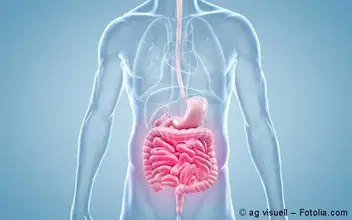Wie Cezmi Akdis, UZH-Professor für Experimentelle Allergologie und Immunologie sowie Direktor des Schweizerischen Instituts für Allergie- und Asthmaforschung (SIAF) betonte, sei es besonders besorgniserregend, dass bei vielen Geräten kein zusätzlicher Spülgang zur Entfernung des restlichen Klarspülers erfolge. „Dadurch verbleiben möglicherweise giftige Substanzen auf dem Geschirr, wo sie schließlich trocknen.“ Beim nächsten Gebrauch des Geschirrs können diese eingetrockneten Chemikalienrückstände leicht in den Magen-Darm-Trakt gelangen.
Dies inspirierte das Forscherteam zu untersuchen, welche Wirkung die Bestandteile handelsüblicher Spülmittel auf die Epithelbarriere des Darms haben.
Auswirkungen eines Defekts der Epithelbarriere
Ein Defekt der Epithelbarriere des Darms wird mit Erkrankungen wie Nahrungsmittelallergien, Gastritis, Diabetes, Adipositas, Leberzirrhose, rheumatoider Arthritis, Multipler Sklerose, Autismus-Spektrum-Störungen, Depression und Alzheimer-Demenz in Verbindung gebracht. Ähnliche Schutzschichten sind auch auf der Haut und in der Lunge vorhanden.
Wie zahlreiche Studien bereits gezeigt haben, können viele Zusatzstoffe und Chemikalien, die uns im Alltag begegnen, diese Schichten beschädigen. „Wir gehen davon aus, dass defekte Epithelbarrieren bei der Entstehung von zwei Milliarden chronischen Krankheiten eine Rolle spielen“, so Akdis. Dieser Zusammenhang wird durch die Hypothese der epithelialen Barriere erklärt, an deren Entwicklung Akdis während seiner mehr als 20-jährigen Forschung auf diesem Gebiet mitgewirkt hat.
Darmorganoide als Testsystem
Das Forscherteam nutzte für die Studie eine neu entwickelte Technologie – menschliche Darmorganoide und Darmzellen auf Mikrochips. Das Gewebe bildet einen dreidimensionalen Zellklumpen, der dem Darmepithel des Menschen sehr ähnlich ist. Das Team analysierte mit verschiedenen biomolekularen Methoden, wie sich handelsübliche Waschmittel und Klarspüler auf diese Zellen auswirken. Sie verdünnten diese Substanzen, um die Mengen widerzuspiegeln, die auf trockenem Geschirr vorhanden wären (1:10.000 bis 1:40.000).
Ergebnisse
Das Ergebnis zeigte, dass hohe Dosen an Spülmitteln die Darmepithelzellen abtöteten und niedrigere Dosen es durchlässiger machten. Darüber hinaus beobachteten die Forscher eine Aktivierung mehrerer Gene und Zellsignalproteine, die Entzündungsreaktionen auslösen könnten. Eine genauere Analyse ergab schließlich, dass für diese Reaktion eine Komponente des Klarspülers, Alkoholethoxylat, verantwortlich war.
Laut Akdis sind diese Erkenntnisse von großer Bedeutung für die öffentliche Gesundheit: „Die von uns nachgewiesenen Effekte können den Beginn der Störung des Darmepithels und vieler chronischer Krankheiten signalisieren.“ Er fordert deshalb, dass Massnahmen schnellstmöglich ergriffen werden und die Öffentlichkeit auf diese Gefahr hingewiesen wird, da Alkoholethoxylat offenbar häufig in gewerblichen Geschirrspülern verwendet werde.
Limitationen
Obwohl die Ergebnisse auf verschiedenen Modellen und auf primären Darmorganoiden basieren, fehlen in der vorliegenden Studie In-vivo-Daten. Weitere Studien sind erforderlich, um zu zeigen, ob die gefundenen Mechanismen auf den Menschen übertragbar sind.