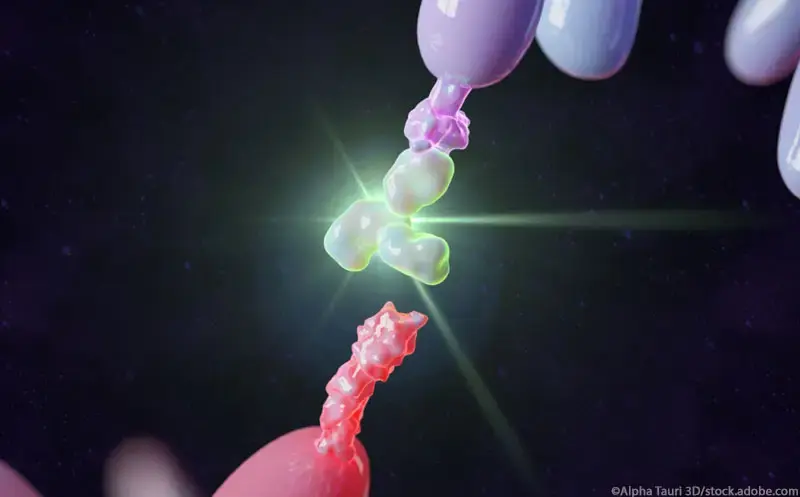
Aktuell gibt es mehr als 16 Zulassungen von Checkpoint-Inhibitoren für die kurative und palliative Therapie einer Vielzahl von Tumoren, und die Zahl der Wirkstoffe und Indikationen steigt weiter an. Checkpoint-Inhibitoren werden vermehrt auch in Kombination mit anderen Therapieprinzipen eingesetzt. „Sie werden als Neurologe nicht darum herumkommen, exponierte Patientinnen und Patienten zu sehen“, ist Professor Dr. Philip Ivany von der Medizinischen Hochschule Hannover überzeugt [1]. Die Neurologie könne diese wirksame Therapie unterstützen, betonte Professor Dr. Thomas Skripuletz, Oberarzt in der Neurologie der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH). Wichtig seien das Erkennen und die Behandlung autoimmuner Reaktionen, die zu neurologischen Komplikationen führen.
FAERS-Daten zu Nebenwirkungen der Checkpoint-Inhibition
In den USA weist das Food and Drug Administration Adverse Event Reporting System (FAERS) allein zwischen Januar 2014 und Dezember 2019 50.406 schwere Nebenwirkungen der Immuncheckpoint-Inhibition aus, von denen 3.619 (7,2%) neurologischer Natur waren [3]. Am häufigsten waren laut Skripuletz Hypophysitis, Myasthenia gravis, Enzephalitis/Myelitis, Meningitis, Guillain-Barre-Syndrom, Vaskulitis und Neuropathie. Die Mortalität bei schweren neurologischen Komplikationen der Checkpoint-Inhibition ist bei Myasthenie mit 35,2% der Betroffenen am höchsten, bei Hypophysitis mit 9,5% am geringsten.
Interdisziplinäre Betreuung
An der MHH gibt es eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe zur Versorgung der Patienten mit Checkpoint-Inhibition, berichtete Skripuletz. Alle Patienten werden vor Beginn der Therapie, aber auch therapiebegleitend und nach Abschluss der Checkpoint-Inhibition neurologisch untersucht. Dabei ist es unerheblich, ob sie wegen einer onkologischen Erkrankung in der Dermatologie, der medizinischen Onkologie, der Gastroenterologie, der Pneumologie oder der Gynäkologie behandelt werden.
Nebenwirkungsdaten aus Hannover
Skripuletz stellte die Ergebnisse der Datenauswertung von 266 Patienten vor, die sich in diesem Rahmen in seiner neurologischen Abteilung vorstellten. 62% der Betroffenen waren männlich, die meisten erhielten Nivolumab, häufigste Tumorerkrankung war mit 60% das Maligne Melanom – die erste Indikation, bei der mit der Checkpoint-Inhibition Erfolge erzielt wurden. 17% litten unter einem Bronchialkarzinom, 14% unter einem Nierenzellkarzinom. Mit der Erweiterung der Indikationen ist davon auszugehen, dass sich auch das Spektrum der onkologischen Patienten, die in der Neurologie vorstellig werden, erweitern wird.
4% schwere neurologische Nebenwirkungen
Schwere, relevante, aber nicht unmittelbar lebensbedrohliche Nebenwirkungen des CTCAE (Common Terminology Criteria of Adverse Events) Grads 3 waren Polyneuropathien mit Paresen, Myositis und Enzephalitis. Es kamen aber auch lebensbedrohliche neurologische Nebenwirkungen (CTCAE Grad 4) vor: ein Myositis-Myasthenie-Overlap mit kardialer Beteiligung und eine schwere Enzephalitis. Die Inzidenz der Nebenwirkungen mit Grad ≥3 sei mit knapp 5% (11/227) in der MHH-Kohorte höher als in klinischen Studien, erläuterte Skrupiletz. Das komme daher, dass die Patienten von Beginn an gesehen werden, glaubt er. Gleichzeitig ist durch die neurologische Mitbetreuung aber auch eine frühe Therapie möglich und kein Betroffener ist bislang verstorben. 137 der 227 Patienten (60,4%) entwickelten keine neurologischen Komplikationen unter der Checkpoint-Inhibition. Die Häufigkeit von neurologischen Nebenwirkungen der Checkpoint-Inhibition mit CTCAE Grad 1 lag bei 23,8% (n = 54), mit Grad 2 bei 11% (n = 25).
Lebensqualität bei Checkpoint-Inhibition hoch
Zu vermeiden sind die neurologischen immunassoziierten Nebenwirkungen bislang nicht. Zudem können auch andere immunassoziierte unerwünschte Ereignisse bei Checkpoint-Inhibition auftreten. Wichtig ist es, sie zu kennen und zu behandeln. Die Lebensqualität bei Checkpoint-Inhibition sei aber hoch, betonte Ivani.










