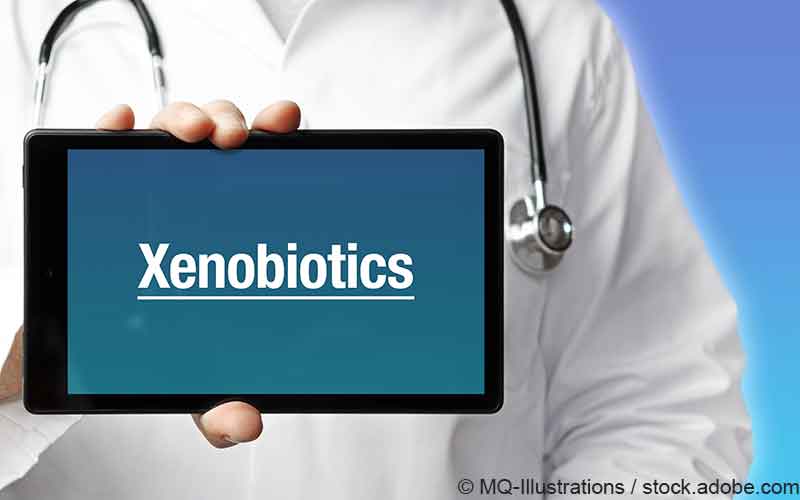
Hintergrund
Weltweit stehen etwa 13% aller Krebsleiden im Zusammenhang mit einer Virusinfektion und zahlreiche Viren unterschiedlicher Familien sind als Karzinogene anerkannt. Dazu gehören verschiedene Typen humaner Papillomaviren (HPV), zwei Typen von Herpesviren einschließlich dem Epstein-Barr-Virus (EBV), das Hepatitis B-Virus und das Hepatitis C-Virus, das Merkelzell-Polyomavirus sowie die beiden Retroviren humanes T-lymphotrophes Virus 1 (HTLV-1) und HIV.
Epstein-Barr-Virus (EBV)
Das im Jahr 1964 entdeckte DNA-Virus gehört zur Familie der Herpesviren (humanes Herpesvirus 4, HHV-4). Ca. 90% der Weltbevölkerung sind damit infiziert. EBV befällt vor allem B-Zellen und Epithelzellen und persistiert überwiegend in latenter Form in B-Zellen. Während der Differenzierung der B-Zellen zu Plasmazellen können die Viren reaktiviert werden.
Die Verbreitung erfolgt durch Kontakt mit infiziertem Speichel (Küssen) sowie durch Husten und Niesen (Tröpfcheninfektion). Erstinfektionen im Kindesalter verlaufen vielfach asymptomatisch. Etwa 50% aller Erstinfektionen bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen verlaufen jedoch mit einer symptomatischen infektiösen Mononukleose (Pfeiffersches Drüsenfieber).
EBV und Krebs
Es ist gezeigt worden, dass EBV in die Entstehung verschiedener Tumortypen involviert ist. So ist eine EBV-Infektion mit dem Hodgkin’s Lymphom, extranodalen Natürlichen Killerzellen (NK)-/T-Zell-Lymphomen und anderen lymphoproliferativen Störungen sowie mit epithelialen Tumoren wie dem Nasopharynxkarzinom (NPC) und gastrischen Karzinomen assoziiert. Darüber hinaus ist EBV in diversen oralen, Brust- und Zervixkarzinomen gefunden worden. Die ätiologische Rolle des Virus dabei wird jedoch noch kontrovers diskutiert.
Da letztendlich nur ein kleiner Teil der mit dem Virus infizierten Menschen EBV-assoziierte Tumore entwickelt, liegt die Vermutung nahe, dass weitere Faktoren für die Onkogenese eine Rolle spielen. In verschiedenen Studien ist gezeigt worden, dass Xenobiotika wie Inhaltsstoffe des Tabakrauchs, Umweltverschmutzung, Pestizide und Lebensmittelchemikalien in die Entwicklung EBV-assoziierter Krebsarten involviert sind. So verändert oxidativer Stress, der durch einige Xenobiotika gefördert wird, sowohl das EBV-Genexpressionsprofil als auch die Wechselwirkung mit dem Wirt, die beide bei der Entstehung des Krebses eine Rolle spielen [1].
Zielsetzung
In einer Übersichtsarbeit haben chilenische Wissenschaftler epidemiologische und experimentelle Daten zu den für die Karzinogenese relevanten Wechselwirkungen zwischen Xenobiotika und EBV zusammengefasst und mechanistische Hypothesen aufgestellt, wonach Xenobiotika den replikativen Zyklus des Epstein-Barr-Virus verändern und Tumorbildung fördern können.
Ergebnisse
In Abhängigkeit vom Zell- und Phänotyp bilden EBV verschiedene Latenztypen. Einige Faktoren, die mit der Differenzierung von B-Lymphozyten oder Epithelzellen in Verbindung stehen, sind auch mit der Aktivierung des lytischen Zyklus verbunden. Dies ist ein hoch regulierter Prozess bestehend aus drei Phasen (unmittelbar früh, früh und spät). Für den Übergang von der Latenzphase zur lytischen Infektion ist unter anderem die Expression der Gene BZLF1 und BRLF1 bedeutsam, die durch die Promotoren Zp und Rp reguliert werden. Die kodierten Proteinen Zta und Rta sind Transkriptionsfaktoren, die nachfolgend die kaskadenartige Expression früher lytischer Virusproteine regulieren.
EBV in epithelialen und lymphoiden Tumoren
Nasopharynxkarzinom (NPC)
NPC ist eine seltene Form von Kopf- und Halskrebs, die häufig in bestimmten Regionen Zentralafrikas und Asien auftritt. Sowohl der Lebensstil als auch soziodemographische Faktoren sind offenbar relevant für die Entwicklung des Tumors. Es gibt drei histologische Typen. Nahezu 100% des am häufigsten vorkommenden Typs (undifferenziertes NPC) weisen EBV auf, was vermuten lässt, dass die Virusinfektion für die Karzinogenese erforderlich ist. Es ist gezeigt worden, dass EBV zahlreiche für die Karzinogenese relevante Signalwege reguliert, unter anderem NF-κB, ERK 1/2, PI3K/Akt/mTOR, Wnt/β-Catenin und JAK/STAT. Darüber hinaus hemmt EBV direkt Tumorsuppressorproteine wie p53 und reduziert durch Förderung der Hypermethylierung indirekt die Expression anderer Tumorsuppressorgene.
Magenkrebs
Magenkrebs steht bei den mit Krebs assoziierten Todesfällen weltweit an dritter Stelle und entsteht wahrscheinlich durch komplexe Interaktionen zwischen Umwelt- genetischen und ernährungsbedingten Faktoren. Eine EBV-Infektion gehört neben Helicobacter pylorii zu den Hochrisikofaktoren für Magenkrebs. Daneben spielen Tabakrauch, Alkoholkonsum sowie die Ernährung (zu wenig Früchte und Gemüse) eine Rolle bei der Entstehung dieses Krebses. Die Prävalenz EBV-assoziierter Magenkarzinome liegt bei 5,0-17,9% weltweit, unterscheidet sich jedoch regional. Eine besonders hohe Inzidenz liegt in Lateinamerika vor.
Hodgkin’s Lymphom (HL)
Abhängig von demographischen Faktoren werden bis zu zwanzig Prozent aller Lymphome den Hodgkin’s Lymphomen zugerechnet. Die EBV-Prävalenz weist soziodemographische Unterschiede auf. Es gibt Hinweise, dass sowohl das Alter bei einer EBV-Primärinfektion als auch eine akute infektiöse Mononukleose Risikofaktoren für das Hodgkin’s Lymphom darstellen.
Burkitt-Lymphom (BL)
Burkitt-Lymphom ist ein aggressives Non-Hodgkin’s Lymphom der B-Zellen, das in vielen Fällen durch eine c-MYC Gentranslokation auf Chromosom 8 charakterisiert und zusätzlich mit EBV- und HIV-Infektionen assoziiert ist. Entsprechend ihrer Ätiologie werden die Lymphome als endemisch, sporadisch oder im Zusammenhang mit einer Immunschwäche klassifiziert. Bei der Ätiopathogenese des Burkitt-Lymphoms gibt es einen klaren Zusammenhang zwischen EBV und soziodemographischen, Umwelt- und geographischen Faktoren.
Gebiete mit hoher Inzidenz an endemischem Burkitt-Lymphom (Sub-Sahara-Regionen in Afrika und Papua Neu Guinea) zeigen eine auffallende Überlappung mit Malariagebieten, und 95% der Fälle in diesen Regionen stehen mit einer EBV-Infektion im Zusammenhang. Das Durchschnittsalter bei Diagnose liegt unterhalb von 7 Jahren, womit es sich beim endemischen Burkitt-Lymphom um einen der häufigsten kindlichen Tumore in diesem Gebieten handelt. Das sporadische Burkitt-Lymphom zeigt ein deutlich anderes Inzidenzprofil und ist die in Nordafrika, Europa und Nordamerika am häufigsten vertretene Variante. EBV-DNA lässt sich hier bei lediglich 20-40% aller Fälle nachweisen. Die dritte Variante des Burkitt-Lymphoms tritt bei immunsupprimierten Patienten auf (nach HIV-Infektion oder Organtransplantation)
Lymphoepitheliales Karzinom (LEC)
Dieser selten auftretende Tumor ist charakterisiert durch ein undifferenziertes Karzinom, das von einem nicht-neoplastischen lymphoplasmazytischen Infiltrat begleitet ist. LEC sind, ähnlich wie die NPC, nicht-keratinisierende Plattenepithelkarzinome, die in Kopf- und Halsregionen jedoch außerhalb des Nasenrachenraums entstehen, sowie in anderen Organen, die mit Epithelzellen ausgekleidet sind. Eine EBV-Infektion wurde bei 87,5% der LEC im Kopf-Hals-Bereich nachgewiesen und bei 96,1% der LEC im Bereich der Speicheldrüsen. EBV-Infektionen waren außerdem bei ca. 90% aller LEC-Proben aus Magen und Lunge vorhanden.
Andere epitheliale Tumore
Neben diversen anderen Faktoren, spielt EBV wahrscheinlich auch eine Rolle beim Zervixkarzinom, Brustkrebs und dem Kolorektalkarzinom. Evidenzen hierfür sind jedoch noch unzureichend und müssen durch weitere Studien untermauert werden.
Fehlgeschlagener lytischer Zyklus als Ursache
Es ist gezeigt worden, dass für die Karzinogenese insbesondere der fehlgeschlagene lytische Zyklus des EBV von Bedeutung ist. Dabei verbleibt EBV im latenten Status und lytische Gene werden nur partiell exprimiert. Aufgrund der ausbleibenden Expression struktureller später Gene, kommt es, im Gegensatz zu einem kompletten lytischen Zyklus, nicht zur Virusreifung und nicht unbedingt zur Zelllyse der infizierten Zellen. Mehrere virale lytische Gene und Proteine, die DNA-Schädigung, Genominstabilität, Zellmigration und die Unterdrückung von Reparaturmechanismen der befallenen Zellen fördern, sind bereits identifiziert worden. Wie genau es zum fehlgeschlagenen lytischen Zyklus kommt ist jedoch noch unklar.
Xenobiotika bei EBV-assoziierten Karzinomen
Tabakrauch
Tabakrauch enthält mehr als 4500 chemische Verbindungen, von denen mindestens 73 ein karzinogenes Potenzial aufweisen. Es ist gezeigt worden, dass diverse Komponenten des Tabakrauchs nicht nur zu einer direkten DNA-Schädigung führen, sondern auch komplexe Interaktionen mit verschiedenen Viren eingehen. So ist Tabakrauch ein Kofaktor bei der Entstehung des HPV-induzierten Zervixkarzinoms und ein Zusammenhang mit Hepatitis B- bzw. C-Viren bei der Entstehung von Leberkrebs wird ebenfalls vermutet.
Ergebnisse zahlreicher Untersuchungen, die Tabakrauch als Kofaktor für EBV-vermittelte Krebsarten wie B-Zell-Lymphome, Magenkrebs und Nasopharynxkarzinom identifizierten, lassen vermuten, dass bestimmte Inhaltsstoffe die Reaktivierung des lytischen Zyklus fördern und mit einer erhöhten Viruslast und -freisetzung einhergehen. Möglicherweise spielen weitere Mechanismen eine Rolle und auch ein additiver Effekt kann nicht ausgeschlossen werden. Um die genaue Rolle von Tabakrauch bei der EBV-assoziierten Karzinogenese in lymphoiden und epithelialen Zellen zu klären, sind weitere Studien nötig.
Pestizide
Insbesondere Organophosphate wie Parathion und Malathion sind vielfach eingesetzte Insektizide (z.B. gegen Mückenplagen oder die Landwirtschaft gefährdende Ungeziefer). Zu den als Herbizid angewendeten Organophosphaten gehört auch Glyphosat. Die Toxizität dieser Substanzen beruht vor allem auf der Entstehung reaktiver Sauerstoffspezies (ROS). Studien zum Zusammenhang zwischen Pestizid/Herbizid-Exposition und EBV-Infektionen bei Krebs sind rar. Es konnte jedoch gezeigt werden, dass Organophosphate wie Chlorpyrifos den lytischen Zyklus von EBV durch oxidativen Stress aktivieren können. Insgesamt ist die Studienlage kontrovers, jedoch gibt es Hinweise, dass Pestizide unter bestimmten Bedingungen das Risiko für hämatologische Erkrankungen, wie Leukämien und Lymphome, erhöhen könnten.
Umweltschadstoffe
Vor allem die Exposition gegenüber schwer abbaubaren organischen Schadstoffen wie Hexachlorbenzol und polychlorierten Biphenylen, sind mit der EBV-Reaktivierung bei Patienten mit Non-Hodgkin-Lymphom und nachfolgendem Anstieg an EBV-Antikörpern in Verbindung gebracht worden. Darüber hinaus ist gezeigt worden, dass Fabrikarbeiter, die über längere Zeit Chemikalien wie Schwefelwasserstoff, Ammoniak, Schwefeldioxid, Fluorwasserstoff, Stickstoffdioxid, Chloriden, Nitroestern und Staub ausgesetzt waren, im Vergleich zu nicht-exponierten Blutspendern signifikant höhere EBV-Antikörperspiegel (Typ IgM und IgG) aufwiesen.
Nahrungsmittelchemikalien
Dioxine sind schwer abbaubare Umweltgifte, die sich vor allem über die Nahrungskette (z.B. Fisch, Fleisch, Eier, Milch) im menschlichen Körper anreichern. Sie werden für die Entstehung diverser Tumore mitverantwortlich gemacht. So sind nach einem Industrieunfall in Italien im Jahr 1976, bei Arbeitern, die akut einer erhöhten Dosis 2,3,7,8-Tetrachlordibenzo-p-Dioxin (TCDD) ausgesetzt waren, vermehrt lymphoide und epitheliale Tumore beobachtet worden.
Studiendaten zeigten, dass die Bindung von TCDD an den Arylhydrocarbonrezeptor (AhR) zu Genexpression und EBV-Reaktivierung in B-Zellen und in epithelialen Speichelzellen führt. Da ein aktivierter AhR die körpereigene Immunantwort auf virale Infektionen modifiziert, ist es plausible zu spekulieren, dass ein solcher Mechanismus auch in die Dioxin-vermittelte Reaktivierung des lytischen Zyklus von EBV und damit assoziierter Karzinogenese involviert ist.
Flüchtige N-Nitrosamine und deren Vorläufer sind neben anderen Faktoren mit der Entstehung eines NPC assoziiert. Auch Buttersäure, die durch Hydrolyse von Glyzeriden entsteht, wenn Butter ranzig wird, ist mit der Entstehung von NPC in Zusammenhang gebracht worden. Darüber hinaus fördern Natriumbutyrat, das Nitrosamid 1-Methyl-3-nitro-1-nitrosoguanidin (MNNG) und der Phorbolester 12-O-tetradecanoylphorbol-13-acetat (TPA) die Genominstabilität und erhöhen die Invasivität EBV-positiver NPC-Zellen. Ein weiteres Toxin, das bei EBV-assoziiertem Krebs eine Rolle zu spielen scheint, ist Aflatoxin B1, das z.B. in Weizen, Mais, Nüssen vorkommen kann. Studiendaten zeigen, dass dafür die Aktivierung des PI3Kinase-Signalwegs erforderlich ist.
Protektive Nahrungsbestandteile
Einige natürliche Bestandteile der Nahrung wirken dagegen protektiv, indem sie die EBV-Replikation und durch EBV geförderte Zellproliferation hemmen. So besitzt das in Kurkuma (Curcuma longa) enthaltene, antioxidierend wirkende Polyphenol Curcumin antitumoröse und antioxidative Eigenschaften, die die Proliferation EBV-positiver NPC-Zellen hemmen können und ihm einen potenziellen therapeutischen Nutzen verleihen. Auch für Cucurbitane aus der Mönchsfrucht (Siraitia grosvenorii) ist ein inhibitorischer Effekt auf die EBV-Reaktivierung gezeigt worden. Das Flavonoid Apigenin unterdrückt die Aktivität der EBV-Promotoren Zp und Rp und ist damit ebenfalls potenziell geeignet zur Vorbeugung einer EBV-Reaktivierung.
Fazit
Tabakrauch, Schadstoffe aus der Umwelt, Pestizide und Nahrungsmittelchemikalien können auf verschiedenen Ebenen in den replikativen Zyklus des Epstein-Barr Virus eingreifen und zur Tumorentstehung beitragen. Modellvorschläge zu möglichen Interaktionen zwischen Xenobiotika und EBV bei der Karzinogenese sind wie folgt:
- Xenobiotika (z.B. Tabakrauch, Pestizide und Dioxine aus Nahrungsmitteln) sind in die lytische Aktivierung und Verbreitung des Virus aus den B-Zellen involviert.
- Interaktionen zwischen EBV und Xenobiotika (z.B. Organophosphate wie Chlorpyrifos und organische Chlorverbindungen sowie Dioxine als Nahrungsmitteltoxin) fördern fehlgeschlagene lytische Infektionen, wodurch sowohl lymphoide als auch epitheliale Tumorprogression gefördert wird.
- Xenobiotika, die oxidativen Stress und DNA-Schädigungen fördern, könnten den Erhalt des EBV-Genoms erleichtern und damit die Latenzetablierung in Epithelzellen während der initialen Phase der Karzinogenese. Diese Möglichkeit muss jedoch durch weiterführende Studien noch bestätigt werden.
- Auch ein synergistischer oder additiver Effekt in EBV-gesteuertem Krebs mit Xenobiotika, die in die Krebsentstehung involviert sind, ist denkbar.
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass zusätzliche Mechanismen der Wechselwirkung zwischen EBV und Xenobiotika bei der Karzinogenese eine Rolle spielen. Um das Wissen für die Prävention und therapeutische Möglichkeiten EBV-assoziierter Krebsarten anwenden zu können, sind weitere Studien zur Aufklärung involvierter Signalwege erforderlich.













