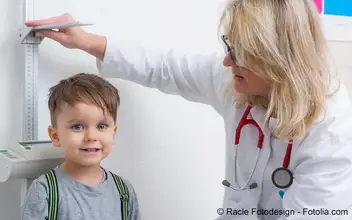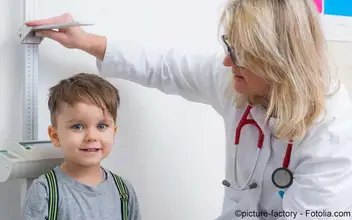Impfungen sind wichtige Präventionsmaßnahmen und zählen zur Basisgesundheitsversorgung von Kindern und Jugendlichen. Gerade auch bei der Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie spielen sie eine zentrale Rolle. Seit Mitte Dezember 2021 können in Deutschland auch Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren gegen SARS-CoV-2 geimpft werden. In den USA wurde kürzlich für den Impfstoff Comirnaty von BioNTech/Pfizer für Kinder zwischen sechs Monaten und fünf Jahren die Zulassung beantragt. Die Impfung an sich stellt jedoch häufig eine Stresssituation für Kinder dar. Die Ständige Impfkommission (STIKO) hat daher auf Basis evidenzbasierter Empfehlungen einige Tipps zur Schmerz- und Stressreduktion bei Impfungen zusammengestellt.
Akzeptanz für Impfungen fördern
Vorweg sei gesagt, dass Schmerzen und Stressreaktionen bei der Impfstoffinjektion nicht ungewöhnlich sind. Allerdings kann die Angst vor möglichen Schmerzen die Einstellung gegenüber Impfungen nachhaltig prägen, sodass ein möglichst schmerz- und stressreduziertes Impfen angestrebt werden sollte, um die Akzeptanz gegenüber Impfungen positiv zu beeinflussen. Neben der richtigen Injektionstechnik spielen hierbei auch altersabhängige Ablenkungsmethoden und bestimmte Verhaltensweisen eine Rolle.
Verhalten des Gesundheitspersonals
Impfungen bei Kindern werden von Kinder- und Jugendärzten, aber auch geschulten medizinischen Fachangestellten (MFA) oder beim Hausarzt durchgeführt. Das Verhalten der impfenden Person kann das Empfinden des Kindes bereits beeinflussen. So sollte das impfende Gesundheitspersonal eine ruhige Ausstrahlung haben, kooperativ und sachkundig sein. Bei der Erklärung des Impfprozesses ist auf einen neutralen Sprachgebrauch zu achten. Fälschlich beruhigende und unehrliche Phrasen („Das tut überhaupt nicht weh.“) sind dabei zu vermeiden.
Lokalanästhetika zur Schmerzlinderung
Laut STIKO können in Einzelfällen Lokalanästhetika-haltige Schmerzpflaster oder Cremes unter einem Okklusionsverband zur Schmerzreduktion bei Kindern angewendet werden. Auch Eisspray, das für zwei bis acht Sekunden aufgesprüht wird, ist eine Option. Hier kann direkt im Anschluss nach Hautdesinfektion geimpft werden. Bei Lokalanästhetika-Präparaten sind folgende Punkte zu beachten.
- Bei Kindern <12 Monaten keine gleichzeitige Anwendung mit Arzneimitteln, die die Methämoglobin-Bildung fördern (z.B. Sulfonamide)
- Die Mindesteinwirkzeit von 30 bis 60 Minuten muss bei der Planung berücksichtigt werden.
Nichtmedikamentöse Unterstützung
Vor dem ersten Impftermin des Kindes (ab zwei Monaten) sollten Eltern über die Anstehenden Impfungen und damit verbundene mögliche Schmerzen und Maßnahmen zur Stressreduktion aufgeklärt werden. Mit Kindern ab drei Jahren sowie Jugendlichen sollten auch direkt vor der Impfung der Ablauf sowie der Umgang mit Schmerzen oder Angst besprochen werden. Die folgenden Ablenkungsmethoden können dabei hilfreich sein.
- Drücken der Hand der Eltern
- Säuglinge: Nuckeln an einem Schnuller oder Stillen während der Impfung
- Kinder <2 Jahren: Trinken von 2 ml einer 25%igen Glukose-Lösung oder anderer süßer Flüssigkeit ein bis zwei Minuten vor der Impfung
- Kinder bis 6 Jahre: Ablenkungsmanöver wie Seifenblasen, Spielzeuge, Videos, Gespräche, Musik vor und nach der Injektion
- Jugendliche: leichtes Husten oder Luftanhalten
Besonderheiten bei der Rotavirus-Schluckimpfung
Wird parallel gegen Rotaviren (RV) geimpft, sollte auf das Stillen vor und während der Impfung verzichtet werden, da dies die Wirksamkeit der Schluckimpfung vermindern kann. Alternativ kann ein Schnuller verwendet werden. Bei Kindern ab zwei Jahren sollte die RV-Schluckimpfung zu Beginn gegeben werden, da sie leicht süßlich schmeckt.
Schmerzhafteste Impfung zum Schluss
Werden mehrere Impfungen am selben Termin gegeben, sollte die schmerzhafteste Impfung laut STIKO zuletzt injiziert werden. Schmerzhaftere Injektionen können beispielsweise die Pneumokokken- und der Masern-Mumps-Röteln (MMR)-Impfung sein.
Körperposition des Kindes
Es wird empfohlen, dass Kleinkinder unter drei Jahren während der Impfung auf dem Arm oder Schoß gehalten und nach der Impfung leicht geschaukelt und liebkost werden. Kinder ab drei Jahren und Jugendliche sollten möglichst aufrecht sitzen. Dabei können Kinder auch auf dem Schoß der Eltern Platz nehmen, da diese so helfen können, die Gliedmaßen still zu halten.
Impfen im Liegen
Patienten, bei denen bekannt ist, dass sie beim Impfen oder anderen medizinischen Interventionen schon einmal ohnmächtig geworden sind, sollten im Liegen geimpft werden
Injektionstechniken
Impfstoffe werden in den meisten Fällen intramuskulär injiziert, die richtige Technik kann hierbei Schmerzen reduzieren. Hilfreich ist beispielsweise eine zügige Applikation. Bei Säuglingen sollte in den medialen Oberschenkel (M. vastus lateralis), ab einem Alter von etwa einem Jahr in den Oberarm (M. deltoideus) injiziert werden.
Aspiration bei COVID-19-Impfstoffen
Unabhängig vom Alter der Patienten rät die STIKO von einer Aspiration ab, da an den Körperstellen, an denen der Impfstoff injiziert wird, keine großen Blutgefäße existieren. Eine Ausnahme bilden COVID-19-Impfstoffe. In ihrem Beschluss zur 18. Aktualisierung der COVID-19-Impfempfehlung empfiehlt die STIKO eine Aspiration bei COVID-19-Impfungen zur weiteren Erhöhung der Impfstoffsicherheit. Grund sind Tierversuche, bei denen nach direkter intravenöser Injektion eines Corona-mRNA-Impfstoffs Fälle von Perimyokarditis auftraten.
Nadellänge
Die STIKO empfiehlt die folgenden Nadellängen bei der Injektion von Impfstoffen.
- Säuglinge <2 Monate: 15 mm
- Ältere Säuglinge, Kleinkinder: 25 mm
- Jugendliche: 25-50 mm
Nicht empfohlene Maßnahmen
Die folgenden Maßnahmen werden von der STIKO explizit nicht zur Schmerzreduktion bei Impfungen empfohlen.
- Erwärmung des Impfstoffs
- Manuelle Stimulation der Injektionsstelle z. B. durch Reiben oder Kneifen
- Orale Analgetika-Gabe vor oder während der Impfung
Infomaterialien des RKI
Die Empfehlungen der STIKO sollen dazu dienen, den Impfprozess für Kind und Arzt möglichst stressfrei zu gestalten und Schmerzen bei der Injektion zu reduzieren. Auf der Website des Robert-Koch-Instituts (RKI) finden sich weitere Materialen zum Thema, wie beispielsweise verschiedene Merkblätter für Ärzte und Eltern sowie Poster für die Praxis.