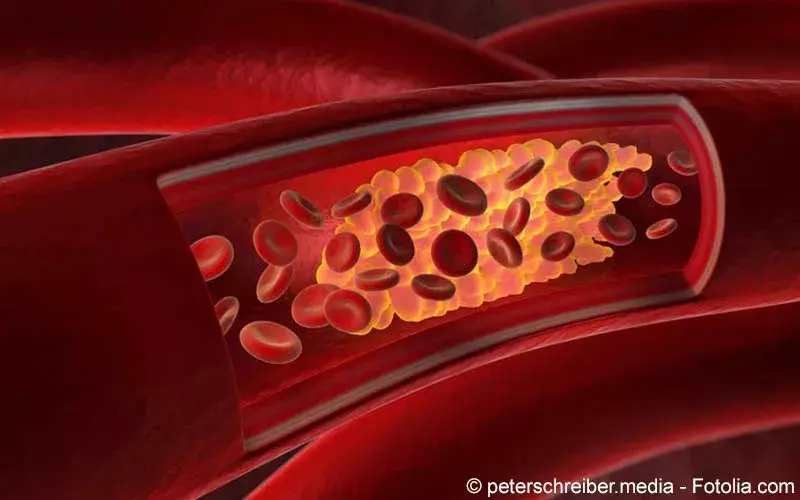
Hintergrund
Die Europäische Atherosklerosegesellschaft (European Atherosclerosis Society [EAS]) hat ein aktualisiertes Konsensus-Statement über die Erkenntnisse der Rolle des Lipoproteins (a) [Lp(a)] bei atherosklerotischen kardiovaskulären Erkrankungen (atherosclerotic cardiovascular disease [ASCVD]) und Aortenklappenstenosen publiziert. Seit der letzten Publikation aus dem Jahre 2010 hat sich auf diesem Gebiet viel getan und im Folgenden sollen die wichtigsten neuen Erkenntnisse zusammengefasst werden.
Wodurch wird die Lp(a)-Konzentration im Plasma bestimmt?
Die Lp(a)-Konzentration im Plasma wird sowohl durch genetische Faktoren als auch durch die ethnische Zugehörigkeit bestimmt. Die Genetik bestimmt dabei zu >90% die Lp(a)-Konzentration, die über den LPA-Genlocus gesteuert wird.
Der Kringle-IV(K-IV) Repeat-Polymorphismus erklärt den größten Teil (30-70%) der Variabilität der Lp(a)-Konzentration. Ebenfalls variiert die Lp(a)-Konzentration je nach ethnischer Zugehörigkeit. So besitzen im Mittel Menschen chinesischer Abstammung eine geringere Lp(a)-Konzentration als kaukasische Menschen.
Menschen afrikanischer Abstammung haben im Mittel die höchste Lp(a)-Konzentration. Schließlich gibt es auch geschlechtsspezifische Unterschiede, wobei die Lp(a)-Konzentration bei Frauen im Allgemeinen etwa 5-10 % höher ist als bei Männern, sowohl bei afrikanischen als auch bei kaukasischen Personen.
Im Gegensatz zu anderen Lipoproteinen kann die Lp(a)-Konzentration nur geringfügig (10-15%) durch eine kohlenhydratarme/fettreiche Ernährung oder durch körperliche Aktivität beeinflusst werden. Bislang ist auch eine medikamentöse Intervention nur in geringem Maße möglich.
Welchen Einfluss hat Lp(a) auf klinische Ereignisse?
Kardiovaskuläre Ereignisse
Beobachtungsstudien und genetische Daten belegen, dass eine hohe Lp(a)-Konzentration kausal für ASCVD, Aortenklappenstenosen sowie für die kardiovaskuläre und Gesamtmortalität bei Männern und Frauen in allen ethnischen Gruppen ist. Die Assoziation zwischen der Lp(a)-Konzentration und diesen Ereignissen ist kontinuierlich und bleibt auch bei sehr niedrigen LDL-C-Konzentrationen bestehen.
Ein Schwellenwert, der eine signifikante Risikozunahme beschreibt, existiert somit nicht. Ebenfalls steigt das Risiko für eine Herzinsuffizienz und für ischämische Schlaganfälle mit höheren Lp(a)-Konzentrationen an.
Diese Erkenntnisse stammen bislang nicht aus randomisierten Studien, die bei einer selektiven Reduktion der Lp(a)-Konzentration eine Verringerung kardiovaskulärer Ereignisse mit sich bringt, sondern aus Studien, die nach dem Prinzip der Mendelschen Randomisierung durchgeführt wurden und somit auf genetischen Ergebnissen basieren.
Thrombotische Ereignisse
Da Lp(a) eine hohe Homologie mit Plasminogen aufweist, wurde unter Experten kontrovers diskutiert, ob Lp(a) ein Risikofaktor für thrombotische Ereignisse ist. Beobachtungsstudien zeigten jedoch nur ein leicht erhöhtes Risiko für venöse Thromboembolien bei Menschen deren Lp(a)-Konzentration über dem 95. Perzentil lag. Mendelsche Randomisierungsstudien zeigten keinen kausalen Zusammenhang.
Diabetes mellitus
Mehrere Studien der letzten Jahre zeigten, dass sehr niedrige Lp(a)-Werte mit einem erhöhten Risiko für Diabetes mellitus Typ 2 einhergehen. Die Metaanalyse der Autoren zeigte ein um 38% erhöhtes Risiko bei Menschen deren Lp(a)-Konzentration im unteren Quintil (<3 bis 5 mg/dL) lag im Vergleich zum oberen Quintil (>27 bis 55 mg/dL). Die zugrunde liegende Ursache ist bislang jedoch noch unbekannt.
Wer sollte den Lp(a) bestimmen lassen?
Das Konsensus-Statement empfiehlt, dass die Lp(a)-Konzentration bei Erwachsenen, bevorzugt im Rahmen der Ersterstellung eines Lipidprofils, einmalig im Leben bestimmt werden sollte. Dies ist übereinstimmend mit den Leitlinien für das Management von Dyslipidämien der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie (ESC).
Bei Jugendlichen wird dies auch empfohlen, wenn ein ischämischer Schlaganfall in der Anamnese vorliegt oder eine Familienanamnese mit vorzeitiger ASCVD oder hohem Lp(a) und keinen anderen identifizierbaren Risikofaktoren.
Die Bestimmung einer möglicherweise erhöhten Lp(a)-Konzentration dient jedoch nicht zur Selektion einer Lp(a)-senkenden Therapie, die ohnehin äußerst limitiert ist, sondern zur Erkennung von Personen mit einem hohen Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse.
Diese sollten sich einer frühzeitigen leitliniengemäßen Anpassung der Lebensumstände unterziehen, um vorhandene kardiovaskuläre Risikofaktoren zu senken. Zu diesen zählen: Hyperlipidämie, Hypertonie, fehlende körperliche Aktivität und Diabetes mellitus.
Wer muss therapiert werden?
Die Autoren des Konsensus-Statement empfehlen ausgewählten Patienten mit sehr hohen Lp(a)-Werten und progedienten atherosklerotischen Gefäßerkrankungen, trotz optimaler Therapie weiterer Risikofaktoren, eine Lp(a)-senkende Therapie in Form einer Lipoprotein-Apherese.
Diese ermöglicht eine kurzfristige, aber substanzielle Absenkung der Lp(a)-Konzentration. Weitere verfügbare Lipidsenker wie PCSK9-Hemmer sind nicht geeignet, da sie Lp(a) nur in ungenügendem Maß senken und demnach nicht für die Risikoreduktion kardiovaskulärer Ereignisse ausreichen. Von einer Therapie mit Niacin wird abgeraten, da in zwei Studien kein klinischer Nutzen festgestellt wurde.
Fazit
Der aktuelle Kenntnisstand belegt einen eindeutigen kausalen und kontinuierlichen Zusammenhang zwischen der Lp(a)-Konzentration und kardiovaskulären Ereignissen in verschiedenen Ethnien. Sowohl erhöhte als auch erniedrigte Lp(a)-Konzentrationen sind kardiovaskuläre Risikofaktoren für Aortenklappenverkalkungen bzw. Diabetes mellitus, selbst bei sehr niedrigen Cholesterinwerten.
Derzeitige Erkenntnisse sprechen aber nicht für ein erhöhtes Risiko von venösen thrombotischen Ereignissen und einer beeinträchtigten Fibrinolyse.










