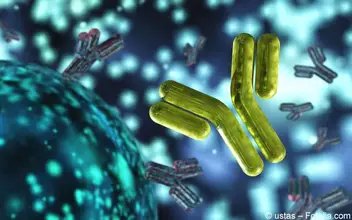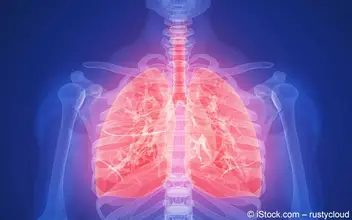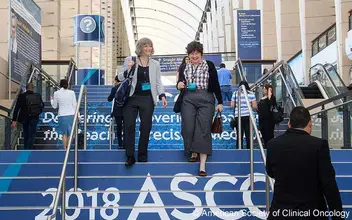Die bislang nicht heilbare Erkrankung Obwohl viele Lymphome heute erfolgreich behandelt werden können, bleibt die Therapie einiger Vertreter dieser Tumorgattung schwierig und mit einer schlechten Prognose verknüpft. Zur Behandlung dieser Tumoren sind aktuell verschiedene immuntherapeutische Ansätze im Visier der Forschung. Dazu gehören Behandlungen mit Checkpoint-Inhibitoren, Bi-specific T cell engager (BiTE) und Chimeric antigen receptor therapies (CAR-T). Prof. Caroline Arber vom Universitätskrankenhaus Lausanne und dem Ludwig Institut für Krebsforschung Lausanne erläuterte in ihrem Vortrag die Wirkprinzipien dieser Therapiekonzepte und stellte erste Ergebnisse bei der Behandlung verschiedener Lymphome vor.
Checkpoint-Inhibitoren
Checkpoint-Inhibitoren sind schon seit geraumer Zeit bekannt und werden bereits erfolgreich eingesetzt. Checkpoint-Inhibitoren sind spezifische Antikörper, die die Signalproteine (Checkpoints) blockieren, die einen Angriff von T-Zellen auf die Tumorzelle hemmen. „Im Grunde lassen die Checkpoint-Inhibitoren einfach die T-Zellen im Mikroumfeld der Tumorzellen von der Leine“, erklärte Arber plastisch. Zu den Checkpoint-Proteinen gehören B7 und PD-L1 auf der Tumorzelle. B7 hemmt bindet an das CTLA-4 der T-Zelle und hemmt so den Angriff. PD-L1 interagiert zum gleichen Zweck mit dem PD-1 auf der T-Zelle.
Studien mit Ipillimumab und Tremelimumab, die CTLA-4 und B7 blockieren, verliefen wenig erfolgreich. Die PD-1 Hemmer Nivolumab und Pembrolizumab konnten hingegen bei Rückfällen des klassischem Hodgkin Lymphoms (cHL) gute Ergebnisse erzielen. Bei Nivolumab lag die Overall Response Rate (ORR) bei 65% und einer geschätzten Dauer des Ansprechens von 8,7 Monaten. Pembrolizumab wies eine ORR von 69% bei einer geschätzten Responsedauer von 11,1 Monaten auf.
BiTE
Bei BiTE handelt es sich um bispezifische Antikörper bzw. Antikörperfragmente, die T-Zellen und Tumorzellen direkt miteinander verbinden und so den Angriff der T-Zelle möglich machen. An der T-Zelle bindet BiTE an CD 3 und an der Lymphomzelle an CD 19.
In einer Untersuchung konnte der bispezifische Antikörper Blinatumumab bei Relapsed-Refractory Diffuse Large B Cell Lymphoma (RR/DLBCL) eine ORR von 43% bei einer medianen Responsedauer von 4-9 Monaten erreichen. Unter der Therapie kam es jedoch auch zu Nebenwirkungen wie Cytokine-Release Syndrom (CRS) und Neurotoxizität.
Chimeric antigen receptor (CAR-T)
Die CAR-Therapie basiert im Prinzip auf T-Zellen des Patienten, die im Labor gentechnisch so umprogrammiert werden, dass sie ein Protein auf der T-Zelloberfläche synthetisieren, das an entsprechende Oberflächenproteine der Tumorzelle (z. B. CD 19 oder CD 28) bindet. Auf diese Weise kann die umprogrammierte T-Zelle an die Tumorzelle binden und sie zerstören.
Das Zellprodukt Axi-Cel (CD 19 CAR T Zellen) erzielte bei Relapsed-Refractory Diffuse Large B Cell Lymphom (RR DLBCL), transformiertem follikulärem Lymphom (FL) und primär mediastinalem B-Zell-Lymphom (PMBCL) ein vollständiges Ansprechen von 54%, eine Teil-Response von 28% und damit eine ORR von 82%.
Allerdings traten unter der CAR-T erhebliche Nebenwirkungen in Form von Neutropenie, Anämie, Thrombozytopenie, Cytokine-Release Syndrom (CRS) und Neurotoxizität auf. Die Nebenwirkungen wurden mit Tocilizumab, Steroiden und supportiv behandelt. Trotz der Behandlung starben drei Patienten infolge ihrer schweren Nebenwirkungen.
Fazit
Bei der Behandlung von wiederkehrendem klassischem Hodgkin Lymphom und Primär mediastinalem B-Zell-Lymphom (PMBCL) erzielten die PD-1 Checkpoint-Inhibtoren Nivolumab und Pembrolizumab gute Ergebnisse. Bei BiTE sind noch Studien zur Optimierung des Ansatzes erforderlich. CAR-T erwies sich als hochwirksam, muss jedoch aufgrund der schwerwiegenden Nebenwirkungen mit Vorsicht eingesetzt werden.