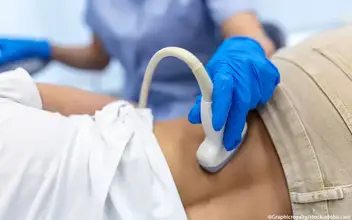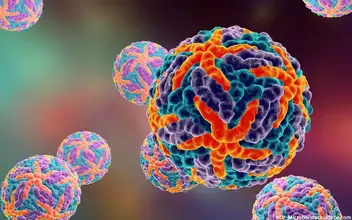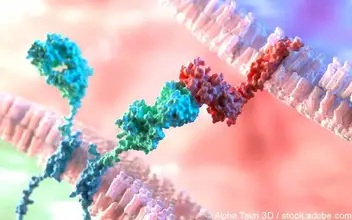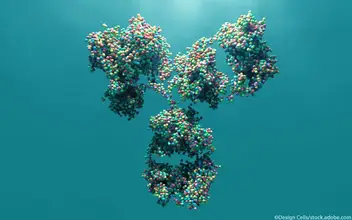Wie wird Suliqua angewendet?
Suliqua wird als Injektionslösung zusammen mit dem oralen Antidiabetikum Metformin zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2 zur verbesserten Einstellung der Blutzuckerkonzentration angewendet. Das Arzneimittel kommt zum Einsatz, wenn der Blutzuckerspiegel durch Metformin allein oder in Kombination mit einem anderen oralen Antidiabetikum oder durch Basalinsulin nicht ausreichend reguliert werden kann. Bevor mit einer Suliqua-Therapie begonnen wird, muss die Behandlung mit Insulin und anderen Antidiabetika, außer Metformin, beendet werden.
Suliqua wird einmal täglich, vorzugsweise immer zur gleichen Uhrzeit, subkutan injiziert. Die Injektion erfolgt unter die Haut von Bauch, Oberschenkel oder Oberarm.
Die Suliqua-Dosis wird für jeden Patienten individuell ermittelt und je nach Ansprechen titriert. Um die niedrigste therapeutische Dosis zu bestimmen, sollte der Blutzuckerspiegel regelmäßig kontrolliert werden.
Wie wirkt Suliqua?
Suliqua enthält die Wirkstoffe Insulin glargin und Lixisenatid. Insulin glargin wirkt in der gleichen Weise wie natürlich gebildetes Insulin. Nach der Injektion gelangt es jedoch langsamer in den Blutkreislauf als das humane Pendant. Daher dauert dessen Wirkung auch länger an. Der zweite Wirkstoff, Lixisenatid, erhöht postprandial das pankreatisch freigesetzte Insulin. Beide Wirkungen optimieren die Kontrolle des Blutzuckerspiegels. Infolge werden Diabetes-Symptome verringert und das Komplikationsrisiko sinkt.
Insulin glargin
Insulin glargin gehört zur Wirkstoffgruppe der Insulinanaloga. Insulin und seine Analoga stimulieren die periphere Glukoseaufnahme, insbesondere durch die Skelettmuskulatur und das Fettgewebe.
Insulin glargin wirkt zwar wie humanes Insulin, wurde aber an drei Stellen strukturell verändert. Durch diese Modifikation wird eine kontinuierliche Abgabe und längere Wirkdauer erreicht. Der Arzneistoff bindet nach Injektion an die α-Untereinheit von Insulin-Rezeptoren (Tyrosinkinase-Rezeptoren). Infolge wird eine Autophosphorylierung ausgelöst. Diese bewirkt eine Translokation des Glukosetransporters Typ-4 (GLUT-4) zur Zelloberfläche sowie eine Glykogensynthese, die die Glukosespeicherung steigert. Zudem wird die hepatische Glukoneogenese gehemmt. Alle Mechanismen tragen somit insgesamt zu einer Senkung des Blutglukosespiegels bei.
Lixisenatid
Lixisenatid gehört zur Wirkstoffgruppe der GLP-1(Glucagon-like peptide)-Rezeptoragonisten. Der GLP-1-Rezeptor ist der Zielrezeptor für natives GLP-1. Das Peptid zählt zu den endogenen Inkretinhormonen, die die glukoseabhängige Insulinsekretion von pankreatischen Betazellen steigert und die Glukagon-Freisetzung aus Alphazellen hemmt.
Lixisenatid stimuliert die Insulinsekretion bei hoher Blutzuckerkonzentration - nicht aber bei Normoglykämie. Dadurch wird das Hypoglykämie-Risiko minimiert. Gleichzeitig wird die Glukagon-Sekretion unterdrückt. Im Falle einer Hypoglykämie bleibt der „Erste-Hilfe-Mechanismus“ der Glukagon-Sekretion aber erhalten.
Nach postprandialer Injektion von Lixisenatid verlangsamt sich die Magenentleerung zusätzlich. Infolge wird die mit der Nahrung aufgenommene Glukose weniger rasch resorbiert und dem Blutkreislauf zugeführt.
Studienlage Suliqua
Suliqua behauptete sich bei der Kontrolle des Blutzuckerspiegels in zwei Phase-III-Studien (LixiLan-O und LixiLan-L). An ihnen nahmen weltweit 1.906 Typ 2-Diabetes-Patienten teil. Hauptindikator für die Wirksamkeit war bei beiden Studien die erzielte Konzentrationsänderung des glykosylierten Hämoglobins (HbA1c) nach 30 Behandlungswochen.
Ergebnisse Studie I
Die erste Studie umfasste 1.170 Probanden, deren Blutzuckerspiegel mithilfe von Metformin mit oder ohne andere orale Antidiabetika nicht hinreichend eingestellt war. Zu Beginn der Studie wurde die Behandlung mit anderen Antidiabetika beendet und die Therapie mit Suliqua oder Insulin glargin oder Lixisenatid, jeweils in Kombination mit Metformin, begonnen. Die Ergebnisse zeigten bei der Einstellung des Blutzuckerspiegels eine Überlegenheit von Suliqua gegenüber den anderen Therapie-Optionen. Der durchschnittliche HbA1c-Wert betrug zu Beginn der Studie 8,1 Prozent und fiel in der Suliqua-Gruppe nach 30 Behandlungswochen auf 6,5 Prozent. In der Insulin glargin-Gruppe gab es eine Reduktion auf 6,8 Prozent und in der Lixisenatid-Gruppe auf 7,3 Prozent.
Ergebnisse Studie II
Die zweite Studie umfasste 736 Probanden. Deren Blutzuckerspiegel konnte trotz Verzögerungsinsulin, wie etwa Insulin glargin - mit oder ohne andere orale Antidiabetika - nicht hinreichend eingestellt werden. Die Patienten beendeten zunächst die Behandlung mit allen oralen Arzneimitteln, außer Metformin, und erhielten dann entweder Suliqua oder Insulin glargin. Der durchschnittliche HbA1c-Wert lag zu Beginn der Behandlung mit Suliqua oder Insulin glargin bei 8,1 Prozent. Nach 30 Behandlungswochen fiel der durchschnittliche HbA1c-Spiegel in der Suliqua-Gruppe auf 6,9 Prozent und bei den Patienten, die Insulin glargin erhalten hatten, auf 7,5 Prozent.
Nebenwirkungen von Suliqua
Die häufigsten Nebenwirkungen von Suliqua sind Hypoglykämie, Schwindel Dyspepsie und gastrointestinale Beschwerden wie Diarrhoe, Nausea und Emesis.
Gegenanzeigen
Bei Überempfindlichkeit gegen einen der Wirkstoffe sollte Suliqua nicht angewendet werden. Suliqua darf aufgrund eines erhöhten Hypoglykämie-Risikos nicht in Kombination mit einem Sulfonylharnstoff gegeben werden. Bei Patienten mit schwerer Nierenfunktionsstörung (Kreatinin-Clearance unter 30 ml/min) oder terminaler Niereninsuffizienz gibt es bislang keine therapeutischen Erfahrungen mit Suliqua. Eine Anwendung wird bei diesen Patienten nicht empfohlen. Die Anwendung von GLP-1-Rezeptoragonisten kann mit gastrointestinalen Nebenwirkungen einhergehen. Bei Patienten mit schweren Erkrankungen des Gastrointestinal-Trakts, inklusive schwerer Gastroparese, wurde Suliqua nicht untersucht. Daher kann bei diesen Patienten auch keine Anwendung von Suliqua empfohlen werden. Bei Patienten mit Pankreatitis in der Anamnese ist Vorsicht geboten.
Lixisenatid verzögert die Magenentleerung und kann so die Resorptionsrate oraler Arzneimittel senken. Werden Arzneimittel eingenommen, die eine schnelle gastrointestinale Resorption erfordern, sollte Suliqua nur mit Vorsicht angewendet werden. Das gilt auch für Arzneimittel, die eine enge therapeutische Breite haben oder eine sorgfältige klinische Überwachung erfordern.
Suliqua wurde nicht in Kombination mit DPP-4-Inhibitoren, Sulfonylharnstoffen, Gliniden, Piogiltazon und SGLT-2-Inhibitoren untersucht. Darüber hinaus gibt es keine Daten für eine Umstellung von GLP-1-Rezeptoragonisten auf Suliqua.
Schwangerschaft und Stillzeit
Bei Frauen im gebärfähigen Alter, die nicht verhüten, rät der Hersteller von einer Anwendung von Suliqua ab. Für Suliqua, Insulin glargin oder Lixisenatid gibt es bislang noch keine klinischen Daten über exponierte Schwangere aus kontrollierten Studien. Deshalb sollte Suliqua während der Schwangerschaft nicht injiziert werden. Möchte eine Patientin schwanger werden oder tritt eine Schwangerschaft ein, ist die Behandlung mit Suliqua abzubrechen. Es ist nicht bekannt, ob Insulin glargin oder Lixisenatid in die Muttermilch übergeht. Deshalb darf Suliqua auch nicht in der Stillzeit angewendet werden.
Besondere Hinweise
Während der Behandlung mit Suliqua war Hypoglykämie die am häufigsten beobachtete Nebenwirkung. Ein Blutzuckerkonzentrations-Abfall kann auftreten, wenn die Suliqua-Dosis höher ist als erforderlich. Folgende Hypoglykämie-verstärkende Faktoren müssen beachtet werden und können eine Dosisanpassung erfordern:
- Wechsel des Injektionsgebietes
- Verbesserung der Insulinsensitivität (zum Beispiel wenn Stressfaktoren entfallen)
- ungewohnte, stärkere oder längere körperliche Anstrengung
- interkurrierende Erkrankungen wie Emesis und Diarrhoe
- unzureichende Nahrungsaufnahme
- versäumte Mahlzeiten
- Alkoholkonsum
- nicht-kompensierte Störungen des endokrinen Systems wie Unterfunktion der Schilddrüse und des Hypophysenvorderlappens sowie Nebennierenrindeninsuffizienz
- gleichzeitige Gabe anderer Arzneimittel wie orale Antidiabetika, ACE-Hemmer und Fibrate
- Kombination mit einem Sulfonylharnstoff.
Während der Behandlung mit Suliqua sollten Patienten auf das potenzielle Dehydrierungsrisiko im Zusammenhang mit gastrointestinalen Nebenwirkungen hingewiesen werden. Darüber hinaus sind Vorkehrungen gegen einen Flüssigkeitsverlust zu treffen. Suliqua kann zur Bildung von Antikörpern gegen Insulin glargin und/oder Lixisenatid führen. In seltenen Fällen erfordern solche Antikörper eine Anpassung der Suliqua-Dosis, um das Risiko von Hyper- oder Hypoglykämien auszugleichen.
Suliqua wird in zwei unterschiedlichen Dosierstärken angeboten. Um versehentliche Verwechslungen zwischen den beiden Suliqua-Pens zu verhindern, sollten Patienten vor jeder Injektion das Pen-Etikett überprüfen. So werden auch Verwechslungen mit anderen injizierbaren Antidiabetika vermieden.Um Dosierungsfehler und eventuelle Überdosierungen zu vermeiden, dürfen sowohl Patienten als auch medizinisches Fachpersonal das Arzneimittel niemals mit einer Spritze aus der Patrone des Fertigpens entnehmen.
Suliqua hat keinen oder nur einen zu vernachlässigenden Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen. Hypo- oder Hyperglykämie sowie Sehstörungen können jedoch die Konzentrations- und Reaktionsfähigkeit beeinträchtigen. Dieses Risiko sollte in Situationen, in denen diese Fähigkeiten von besonderer Bedeutung sind - beispielsweise beim Autofahren oder beim Bedienen von Maschinen - beachtet werden. Es ist ratsam, dass Patienten Vorsichtsmaßnahmen treffen, um Hypoglykämien beim Führen von Kraftfahrzeugen oder beim Bedienen von Maschinen zu vermeiden. Dies ist insbesondere bei Patienten wichtig, die eine verringerte oder fehlende Wahrnehmung von Hypoglykämie-Warnsymptomen haben oder zu häufigen Hypoglykämie-Episoden neigen. In diesen Fällen sollte das Führen eines Kraftfahrzeuges oder das Bedienen von Maschinen sorgfältig überdacht werden. Suliqua enthält Natrium. Mit einem Verhältnis von weniger als 1 mmol (23 mg) pro Dosis gilt das Arzneimittel jedoch als nahezu „natriumfrei“. Suliqua enthält 2,7 mg Metacresol pro Milliliter. Dieser Hilfsstoff kann mitunter allergische Reaktionen auslösen.
Aufbewahrung und Haltbarkeit
Verwendete Pens sollten nicht über 30 Grad Celsius gelagert, aber auch nicht im Kühlschrank aufbewahrt oder eingefroren werden. Vor der ersten Anwendung muss der Pen aus dem Kühlschrank entnommen und 1 bis 2 Stunden bei einer Temperatur unter 30 Grad aufbewahrt werden. Suliqua-Pens sind vor direkter Hitzeeinwirkung und direktem Licht geschützt aufzubewahren. Die Penkappe muss nach jeder Injektion wieder auf den Pen gesetzt werden, um ihn vor Licht zu schützen. Eine Lagerung mit aufgesteckter Nadel ist nicht zulässig. Nach der ersten Anwendung sind Suliqua-Pens 14 Tage verwendbar. Suliqua darf nicht mit einem anderen Insulin gemischt oder verdünnt werden.
Noch nicht verwendete Pens sollten im Kühlschrank bei 2 bis 8 Grad Celsius lagern. Die Aufbewahrung darf nicht in der Nähe des Gefrierfachs oder eines Kühlelements erfolgen. Noch nicht verwendete Pens dürfen keinesfalls eingefroren werden. Der Hersteller empfiehlt eine Aufbewahrung im Umkarton, um den Inhalt vor Licht zu schützen.Leere Pens dürfen nicht wieder verwendet werden und sind vorschriftsgemäß zu entsorgen. Um einer mögliche Übertragung von Krankheiten zu vermeiden, darf jeder Pen nur von einem Patienten benutzt werden. Zudem ist bei jeder Injektion stets eine neue Nadel zu verwenden.
Weitere Details zu diesem Medikament können Sie der vorliegenden Fachinformation entnehmen.