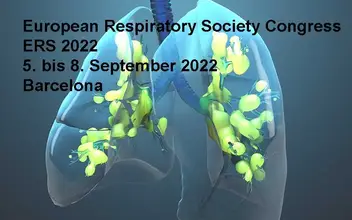Zu Beginn seines Vortrages präsentierte Professor Dr. Thomas Pieber, klinische Abteilung für Diabetologie und Endokrinologie, medizinische Universität Graz, Zahlen zum Risiko kardiovaskulärer Erkrankungen bei Patienten mit Typ-2-Diabetes [1]. In einer großen Kohorte mit fast einer Million Teilnehmern zeigte sich, dass Patienten mit Typ-2-Diabetes im Vergleich zu gesunden Individuen ein doppelt so hohes Mortalitätsrisiko durch kardiovaskuläre Erkrankungen haben [2].
Anschließend stellte Pieber die verschiedenen Substanzklassen von Medikamenten vor, die zur Therapie von Diabetes eingesetzt werden und gleichzeitig das Risiko kardiovaskulärer Erkrankungen verringern sollen. Ob dies für alle folgenden Substanzklassen (DPP-4-Inhibitoren, SGLT2-Inhibitoren, GLP-1-Rezeptor-Agonisten) zutrifft, analysierte der Referent anhand der aktuellen Studienlage.
DPP-4-Inhibitoren
Wirkmechanismus
Inhibitoren der Dipeptidylpeptidase-4 (DPP-4-Inhibitoren) greifen in das körpereigene Inkretin-System ein, welches an der Regulierung der Blutglukose beteiligt ist. DPP-4 inaktiviert Glucagon-like peptide-1 (GLP-1) und Glucose-dependent insulinotropic polypeptide (GIP). Durch die Hemmung der Enzyme kommt es zu höheren, aber physiologischen Konzentrationen von aktivem GLP-1 und GIP. Insgesamt führen DPP-4-Inhibitoren zu einer erhöhten Insulinfreisetzung und einer verminderten Glucagonsekretion, was in einer verminderten Glukosekonzentration resultiert.
Kardiovaskulärer Outcome verschiedener DPP-4-Inhibitoren
Verschiedene Studien, die den kardiovaskulären Outcome der DPP-4-Inhibitoren Alogliptin, Saxagliptin und Sitagliptin untersuchten, konnten keinen kardiovaskulären Benefit für die Wirkstoffe zeigen. Es gab diesbezüglich keinen Unterschied zu Placebo.
Auch für weitere DPP-4-Inhibitoren, etwa Vildagliptin und Linagliptin, konnten keine Vorteile in der Prävention kardiovaskulärer Ereignisse gezeigt werden. Demnach gibt es keine Unterschiede zwischen den einzelnen DPP-4-Inhibitoren.
SGLT2-Inhibitoren
Wirkmechanismus
Inhibitoren des Natrium-Glukose-Transporters 2 (sodium glucose transporter, SGLT2) vermindern die Rückresorption von Glukose in der Niere. SGLT2 ist für 90% der renalen Glukoserückresorption verantwortlich. Dadurch wird der Blutglukosespiegel gesenkt.
Unter SGLT2-Hemmern ist das Risiko einer Hypoglykämie gering, die Wirkung ist unabhängig von der ß-Zell-Funktion. Durch diesen Wirkmechanismus ist die Kombination mit anderen Antidiabetika möglich. Unter SGLT2-Hemmern kommt es zu einer Reduktion des Körpergewichts und des Blutdrucks.
Zu den SGLT2-Inhibitoren zählen Canagliflozin, Dapagliflozin und Empagliflozin.
Kardiovaskulärer Outcome verschiedener SGLT2-Inhibitoren
In der EMPA-REG-Studie [3] wurden Patienten mit Typ-2-Diabetes und einer kardiovaskulären Erkrankung untersucht. Die Patienten in der dreiarmigen Studie erhielten entweder Empagliflozin (10 mg oder 25 mg einmal täglich) oder Placebo. Unter Empagliflozin war die Hazard Ratio (HR) für kardiovaskulären Tod im Vergleich zu Placebo statistisch signifikant (p < 0,0001) verringert.
Der SGLT2-Inhibitor Canagliflozin wurde in der CANVAS/CANVAS-R-Studie untersucht [4]. Die Studienteilnehmer litten und Typ-2-Diabetes, waren entweder 30 Jahre und älter mit einer symptomatischen, artherosklerotischen Erkrankung in der Historie oder waren 50 Jahr und älter und wiesen zwei oder mehr Risikofaktoren für eine kardiovaskuläre Erkrankung auf. Die Ergebnisse zeigten eine signifikante Reduktion kardiovaskulärer Ereignisse unter Canagliflozin im Vergleich zu Placebo.
Somit zeigt die Klasse der SGLT2-Inhibitoren einen Nutzen was die Reduktion kardiovaskulärer Ereignisse bei Patienten mit Typ-2-Diabetes betrifft.
GLP-1-Rezeptor-Agonisten
Wirkmechanismus
GLP-1 (Glucagon-like peptide-1)-Agonisten binden analog dem Peptidhormon GLP-1 an den GLP-1-Rezeptor, fördern die Insulinsekretion und hemmen die Glucagonausschüttung. Im Gehirn führen diese Agonisten zu einer Steigerung des Sättigungsgefühls. Der systolische Blutdruck wird gesenkt und die Herzfrequenz wird gesteigert.
Zu den GLP-1-Rezeptor-Agonisten zählen:
- Exenatid
- Lixisenatid
- Liraglutid
- Albiglutid
- Dulaglutid
- Semaglutid (nicht zugelassen).
Kardiovaskulärer Outcome verschiedener GLP-1-Rezeptor-Agonisten
Die Effekte auf den kardiovaskulären Outcome der verschiedenen GLP-1-Rezeptor-Agonisten wurden ebenfalls in verschiedenen Studien untersucht.
Hier lässt hinsichtlich der Reduktion kardiovaskulärer Ereignisse keine klare Aussage treffen, die für die gesamte Gruppe gilt. Während Lixisenatid keinen und Exenatid nahezu keinen Effekt auf die Reduktion des kardiovaskulären Risikos haben, ist bei Liraglutid und Semaglutid ein Effekt vorhanden.
Die Heterogenität innerhalb dieser Gruppe könnte auf die Basis der Wirkstoff zurückzuführen sein, so Pieber. Exenatid und Lixisenatid basieren auf Exendin-4, einem Polypeptid aus dem Speichel der nordamerikanischen Gila-Echse Heloderma suspectum. Die anderen GLP-1-Rezeptor-Agonisten hingegen basieren auf humanen GLP-1-Analoga.
Fazit
Abschließend fasste Pieber die Profile der vorgestellten Antidiabetika zusammen:
- DDP-4-Inhibitoren: nicht geeignet, um das Risiko kardiovaskulärer Ereignisse bei Patienten mit Typ-2-Diabetes zu senken
- SGLT2-Inhibitoren: geeignet, um das Risiko kardiovaskulärer Ereignisse bei Patienten mit Typ-2-Diabetes zu senken
- GLP-1-Rezeptor-Agonisten: Exatinid und Lixisenatid sind nicht geeignet, um das Risiko kardiovaskulärer Ereignisse bei Patienten mit Typ-2-Diabetes zu senken; Liraglutid und Semaglutid sind geeignet.