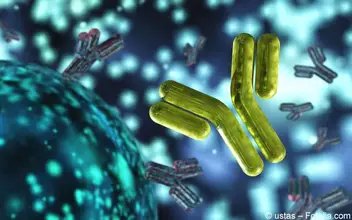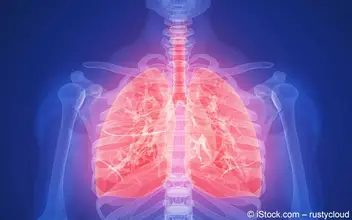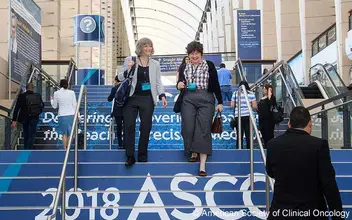Die Immuntherapie spielt eine wichtige Rolle bei Patienten mit Kopf-Hals-Tumoren. Sie ist bei wiederkehrenden Tumoren wirksam und etabliert. Das Sicherheitsprofil gibt keinen Anlass zu Bedenken. Prof. Cohen vom Moores Cancer Center der University of California in San Diego, USA, berichtete anlässlich des ESMO 2018 in München über die aktuellen Untersuchungen von Immuntherapeutika in laufenden klinischen Studien [1].
Anhaltender Therapieerfolg bei Anti-PD-1/-PD-L1-Monotherapien
Daten der CheckMate-141-Studie (Phase III) über zwei Jahre zeigen, dass der Checkpoint-Inhibitor Nivolumab eine Immunevasion von Tumorzellen verhindern und die Überlebenszeit von Patienten mit rezidiviertem Kopf-Hals-Tumor verlängern kann, ohne die Lebensqualität zu verschlechtern.
In der KEYNOTE-040-Studie wurde Pembrolizumab mit der Standardtherapie (Methotrexat, Docetaxel oder Cetuximab) bei Patienten mit rezidivierendem oder metastasiertem Plattenepithelkarzinom des Kopf-Hals-Bereiches mit progredientem Krankheitsverlauf oder nach platinhaltiger Chemotherapie verglichen. Es zeigte sich ein Vorteil der Anti-PD-1-Therapie Bezüglich des Mortalitätsrisikos. Cohen hebt die Dauer der Therapieffekte über bis zu 18 Monaten hervor.
Daten zu Immun-Kombitherapien zu erwarten
Bisher gibt es, so Cohen, keine vergleichbar wirksamen Therapien und es sind noch bessere Ergebnisse bei lokal fortgeschrittenen Erkrankungen zu erwarten.
Vielversprechende Effekte in Kombination mit Radiotherapie
Die Strahlentherapie interagiert in vielerlei Hinsicht positiv mit Immuntherapie und Anti-PD-1:
- Erhöhung des PD-L1-Expression
- Erhöhung der Antigenexpression
- Neue Antigenpräsentation
- Synergistische Effekte
Optimierungspotenzial
- bei der zeitlichen Therapiesteuerung (neoadjuvant, gleichzeitig, adjuvant)
- bei der Wahl geeigneter Patientenpopulationen. Hochrisikopatienten und Patienten mit Erkrankungen im Endstadium werden weniger für eine Immuntherapie in Frage kommen als Patienten mit geringem Risiko und in frühen Erkrankungsstadien.
Weiter vorliegende Studiendaten
Eine Reihe von Studien belegt das Potenzial der Immuntherapie bei Kopf-Hals-Tumoren:
- Sicherheit von Pembrolizumab [2]
Powell et al. zeigen anhand von Daten von 27 Patienten mit lokal fortgeschrittenem Kopf-Hals-Plattenepithelkarzinom, dass die zusätzliche Gabe von Pembrolizumab zur Radiochemotherapie mit Cisplatin die Toxizität der Standardtherapie nicht erhöht.
- RTOG 3504
In dieser Phase-IIR-Studie wurde die Sicherheit einer zusätzlichen Gabe von Nivolumab bei Chemotherapien mit wöchentlicher Gabe von Cisplatin, Hochdosis-Cisplatin, Cetuximab oder Bestrahlung allein bei Patienten mit lokal fortgeschrittenem Kopf-Hals-Plattenepithelkarzinom belegt.
- REACH
Ziel dieser Studie ist es zu zeigen, dass die Behandlung mit Avelumab in Kombination mit Radiotherapie-Cetuximab der Standardbehandlung mit Cisplatin-Radiotherapie und/oder der Standardbehandlung mit Radiotherapie-Cetuximab allein in Bezug auf das progressionsfreie Überleben von Patienten mit lokal fortgeschrittenem Kopf-Hals-Plattenepithelkarzinom überlegen ist. Bisher ergaben sich keine Anhaltspunkte für eine Toxizität der Immuntherapie außerhalb des erwarteten Profils.
Aktuelle Studien
Von folgenden laufenden Studien sind vielversprechende Daten zu erwarten:
- JAVELIN HEAD AND NECK 100
Diese randomisierte, plazebokontrollierte Phase-III-Studie schließt Patienten mit einem Plattenepithelkarzinom im Bereich von Mund, Rachen oder Kehlkopf ein. Es sollen die Sicherheit und Antitumoraktivität von Avelumab in Kombination mit Standard-Radiochemotherapie im Vergleich zu Standard-Radiochemotherapie allein bewertet werden.
- KEYNOTE-412
In dieser Phase-III-Studie wird Pembrolizumab in Verbindung mit Radiochemotherapie im Vergleich zu Radiochemotherapie allein bei Patienten mit lokal fortgeschrittenem Kopf-Hals-Plattenepithelkarzinom untersucht.
- NRG-HN004
Forscher untersuchen in dieser randomisierte Phase-II/III-Studie die Wirksamkeit von Strahlentherapie mit Durvalumab oder Cetuximab bei der Behandlung von Patienten mit Kopf-Hals-Karzinom im Stadium III-IVB, die Cisplatin nicht einnehmen können.
Cohen geht davon aus, dass in Zukunft noch eine Reihe an therapeutischen Optionen auf immunologischer Basis erschlossen werden. Mit dem Verständnis der Tumoreigenschaften auf molekularer Ebene werden personalisierte Ansätze möglich sein. Außerdem werden Kombinationen mit anderen Immuntherapien, zum Beispiel T-Zell-stimulierende Behandlungen eine Rolle spielen.