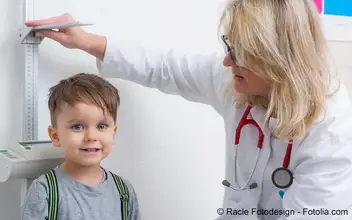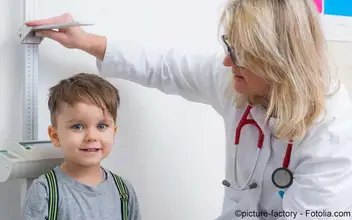Die Gesundheit von Kleinkinder und Babys ist bei Hitze besonders gefährdet. Sie sind anfälliger für Hitzebeschwerden und dehydrieren schneller. Das liegt unter anderem an dem zu Erwachsenen unterschiedlichen Aufbau der Haut, der sie empfindlicher macht gegenüber Schädigungen durch UV-Strahlung. Zudem ist die Schweißproduktion bei Kindern geringer, die Stoffwechselrate allerdings erhöht. Die im Verhältnis zum Körpergewicht größere Hautoberfläche erschwert außerdem die Anpassung an die hohen Temperaturen.
Langfristige Folgen
Sonnenbrände und eine zu hohe Aussetzung von UV-Strahlung haben langfristige Folgen. Ein Sonnenbrand in der Kindheit erhöht das Risiko für schwarzen Hautkrebs (malignes Melanom) um das Zwei- bis Dreifache. Zudem ist die Linse der Kinder durchlässiger für UV-Strahlung als die Erwachsener, so dass mehr UV-Strahlung bis zur Netzhaut im Auge gelangen kann. Eine UV-Bestrahlung der Augen von Kindesbeinen an erhöht daher das Risiko für einen Grauen Star (Katarakt). Babys und Kleinkinder müssen daher besonders geschützt werden.
Grundsätzliche Schutzmaßnahmen
Eltern wird empfohlen auf Hitzewarnungen zu achten und den UV-Index von April bis September im Blick zu behalten. Kinder unter einem Jahr sollten grundsätzlich keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden. Kleinkinder bis 4 Jahre sollten insbesondere die intensive Mittagssonne zwischen 10 Uhr und 17 Uhr meiden. Ab einem UV-Index von 3 ist ein Sonnenschutz erforderlich, ab einem UV-Index von 8 unbedingt notwendig.
Insbesondere nachts sollten sich Babys und Kleinkinder im kühlsten Raum aufhalten. Tagsüber sollte hier die Temperatur nicht über 26°C betragen. Aktivitäten im Freien werden am besten in den kühleren Morgen- und Abendstunden durchgeführt. Generell sollten sich die Kinder bevorzugt im Schatten aufhalten.
Der richtige Sonnenschutz
Der Sonnenschutz bei Kindern ist aufgrund der allgemein empfindlichen Haut unabhängig vom Hauttyp. Für Kinder sollten spezielle, wasserfeste und parfümfreie Sonnencremes sowie Lippenpflegestifte mit einem Lichtschutzfaktor (LSF) von mindestens 30 und einem Schutz sowohl vor UV-A- als auch UV-B-Strahlung verwendet werden. In großen Höhen sowie am und im Wasser und in sonnenreichen Regionen ist ein LSF von 50+ ratsam.
Anwendung von Sonnencreme
Kinder unter einem Jahr sollten aufgrund der empfindlichen Haut vorzugweise mit anderen Maßnahmen als Sonnencremes geschützt werden. Auch bei Kindern, die älter als 12 Monate sind empfiehlt sich, nur die Körperstellen einzucremen, die nicht von Kleidung bedeckt sind. Der Sonnenschutz wird eine halbe Stunde vor dem Verlassen des Hauses aufgetragen. Dabei gilt der Grundsatz „viel hilft viel“. Es sollte eine Sonnencreme-Menge von etwa 2 mg/cm2 Körperoberfläche aufgetragen und alle zwei Stunden nachgecremt werden. Bei einer Abkühlung mit oder im Wasser sollten die Kinder ebenfalls erneut eingecremt werden. Wichtig ist, dass das Nachcremen den Sonnenschutz nicht verlängert, sondern lediglich aufrechterhält!
Passende Kleidung
Insbesondere Babys können mit geeigneter Kleidung vor der Sonne geschützt werden. Es empfehlen sich leichte, lockersitzende Kleidungsstücke in hellen Farben, die möglichst den ganzen Körper bedecken. Es sollten dicht gewebte Materialien wie Viskose oder dünne Baumwolle gewählt werden, auch spezielle UV-Schutz-Kleidung ist im Handel. Zudem sollten die Kinder einen Kopfschutz tragen, der auch Nacken schützt sowie eine bruchsichere Sonnenbrille mit UV-400.
An der Stelle zwischen den Schulterblättern unterhalb des Nackens kann überprüft werden, ob das Kind richtig gekleidet ist. Die Haut sollte dort warm, aber nicht verschwitzt sein.
Ausreichende Flüssigkeitszufuhr
Die empfohlene Trinkmenge für ein 2- bis 6-jähriges Kind liegt laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) bei etwa drei Viertel bis einem Liter Flüssigkeit pro Tag. Bei über 30°C wird die doppelte bis dreifache Menge empfohlen. Am besten eignen sich Wasser, ungesüßte Früchte- und Kräutertees sowie Saftschorlen, die gekühlt, aber nicht eiskalt sind. Säuglinge sollten häufiger gestillt werden als gewohnt.
Hitzeerkrankungen
Sollte sich das Kind doch zu lange in der Sonne aufgehalten haben, können verschiedene Hitzeerkrankungen auftreten. Es ist wichtig, diese rechtzeitig zu erkennen und entsprechende Maßnahmen einleiten zu können.
Sonnenbrand
Bei einem Sonnenbrand sollte das Kind vor weiterer UV-Strahlung geschützt werden. Kalte, aber nicht zu kalte, feuchte Umschläge sowie kühlende Cremes und Gele können die Symptome lindern. Außerdem sollte Reibung an den betroffenen Hautstellen vermieden werden. Bei Verbrennungen 2. oder 3. Grades muss ein Arzt aufgesucht werden.
Sonnenstich
Ein Sonnenstich kann durch einen längeren Aufenthalt des Kindes mit dem Kopf in der Sonne entstehen. Häufige Symptome sind Kopfschmerzen, Übelkeit und Nackenschmerzen. Erste-Hilfe-Maßnahmen sind hierbei Abkühlung und ausreichende Flüssigkeitszufuhr. Zudem sollte zeitnah ein Arzt aufgesucht werden.
Hitzestress bis Hitzeerschöpfung
Bei einem längeren Aufenthalt in sehr warmer Umgebung kann es zu Hitzestress und bis zur Hitzeerschöpfung kommen. Typische Symptome sind:
- Fieber
- Starkes Schwitzen
- Kühle Haut
- Gerötetes Gesicht
- Trockene Lippen
- Kopfschmerzen
- Übelkeit
- Ohrgeräusche
- Erschöpfung
- Nachlassende Konzentration
Die Symptome sollten ernst genommen werden, um einen Hitzschlag zu vermeiden. Betroffene Kinder sollten in kühle Innenräume gebracht werden. Feuchte Umschläge können ebenso hilfreich sein. Zudem sollte auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr geachtet werden.
Hitzschlag
Hitzeerschöpfung kann zu Hitzschlag führen, der lebensbedrohlich werden kann. Symptome sind erhöhte Körpertemperatur, heiße und rote Haut, die nicht schwitzt, sowie starke, stechende Kopfschmerzen. Beim Hitzschlag handelt es sich um einen medizinischen Notfall, der entsprechend notärztlich versorgt werden sollte.
Differentialdiagnose COVID-19
Symptome wie Erschöpfung, Kopfschmerzen, Kurzatmigkeit, Übelkeit und Appetitlosigkeit sowie erhöhte Temperatur und Fieber können neben einer Hitzeerkrankung auch Zeichen einer Infektion mit dem Coronavirus sein. Eltern sollten darauf hingewiesen werden, auch diese Möglichkeit in Betracht zu ziehen und sich an eine entsprechende Hotline oder ihren Arzt zu wenden.
Photosensitivität durch Arzneimittel
Zu beachten ist außerdem, dass einige Arzneimittel als unerwünschte Nebenwirkung zu einer Photosensitivität führen können, die Hautreaktionen infolge von Sonneneinstrahlungen verursachen. Das gilt sowohl für oral eingenommene Medikamente als auch topisch angewendete Substanzen. Zu diesen Arzneimitteln zählen beispielsweise bestimmte Antibiotika wie Fluorchinolone und Tetrazykline, einige Antimykotika, Antihistaminika, nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR), Retinoide und Sulfonylharnstoffe. Eine Auflistung der Photosensibilisatoren finden Sie hier.
Auch bestimmte Hygienemittel wie Parfüm (insbesondere mit Bergamotte), Zitrusfrüchte, Sellerie und Bärenklau (Herkulesstaude) verursachen eine Photosensitivität.