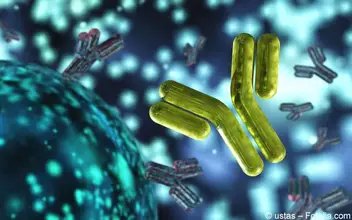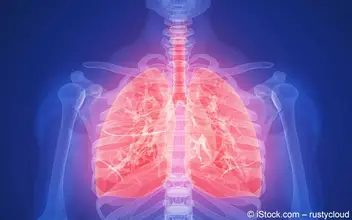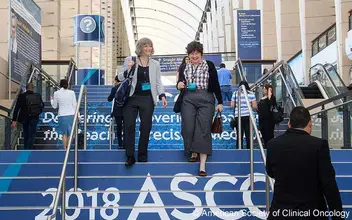Im Gehirn siedeln sich häufiger Metastasen ab, als dass primäre Tumoren entstehen. Es gibt etwa 10mal häufiger Gehirnmetastasen als beispielsweise Gliome. Bei der Entwicklung von Gehirnmetastasen beträgt die durchschnittliche Überlebenszeit der Patienten nur noch Monate.
Tatsächlich kommt es bei etwa 20% der Krebspatienten zu einer Metastasierung im Gehirn – mit steigender Tendenz, wie Professor Frank Winkler, Geschäftsführender Oberarzt der Neurologie und Poliklinik am Universitätsklinikum Heidelberg und Leiter der Arbeitsgruppe Experimentelle Neuroonkologie am Deutschen Krebsforschungszentrum, in seinem Vortrag auf dem ESMO-Kongress darlegte [1].
Rückzugsgebiet für Tumorzellen
Winkler sieht eine Ursache für die steigende Inzidenz von Gehirnmetastasen in der erfolgreicheren Kontrolle der extrakraniellen Ursprungstumoren: „Das besondere Problem bei der Behandlung von Gehirnmetastasen ist ihr Siedlungsgebiet. Im Gehirn ist eine effektive Krebstherapie viel komplizierter als in anderen Organen. Es bietet den Tumorzellen eine Art Schutzraum oder Rückzugsgebiet.“, erklärte Winkler und fuhr fort: „Daher ist gerade bei Gehirnmetastasen eine multidisziplinäre Kooperation von Spezialisten unerlässlich.“
Aufgaben des Tumorboards
Für eine effektive Therapie von Gehirnmetastasen sollten Neuroonkologen, Neuroradiologen, Neurochirurgen, Radioonkologen sowie die entsprechenden Organspezialisten in einem Tumorboard eng zusammenarbeiten. Das Tumorboard muss dabei vor allem folgende Kriterien vor der Therapieentscheidung im Einzelfall klären:
- Klinischer Status des Patienten: Klassifikation nach WHO-ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group)
- Neurologische Symptome
- Ausmaß der Metastasierung im Gehirn (Anzahl der Metastasen, Größe der Läsionen)
- Ausmaß der extrakraniellen Metastasen
- Therapie gegen die systemische Erkrankung
- Dynamik der Tumorprogression
- Neurochirurgische Optionen / Optionen für eine stereotaktische Radiochirurgie (SRS)
- Status der Treibermutationen
- Gibt es Studien?
Therapieansätze im Überblick
Zur Behandlung von Gehirnmetastasen können folgende Methoden zum Einsatz kommen:
- Neurochirurgie
- Radiotherapie, sowohl als Whole brain radiotherapy (WBRT), als auch als SRS oder SRT stereotaktische Radiotherapie.
- Chemotherapie
- Zielgerichtete Therapien: Tyrosinkinase-Inhibitoren (TKI) oder monoklonale Antikörper
Im Rahmen der supportiven Therapie geht es bei Gehirnmetastasen vor allem um die Kontrolle von Ödemen, Schmerzbehandlung und eine antikonvulsive Therapie.
Neurochirurgie
Ein neurochirurgischer Eingriff ist bei Patienten mit wenigen, gut operablen Läsionen, kontrollierter extrakranieller Tumorlast und einem guten Allgemeinzustand angezeigt. Die Operation kann eine rasche Dekompression bei Patienten mit signifikantem Masseneffekt von einer oder mehreren Metastasen bewirken. Bei einem unbekannten Primärtumor ist die Neurochirurgie eine Option, Gewebe für die histopathologische und molekulare Untersuchung zu gewinnen. „Da sich die molekularen Eigenschaften von Gehirnmetastasen von ihrem Ursprungstumor unterscheiden können, ist die Untersuchung des Metastasen-Gewebe auch bei bekanntem Primärtumor sinnvoll und kann bei der Therapieplanung überaus hilfreich sein.“, führte Winkler aus.
Radiotherapie
Eine WBRT kann bei vielen Metastasen und bei Mikrometasen angezeigt sein. Die Nebenwirkungen, insbesondere kognitive Einschränkungen und Veränderungen an den intrazerebralen Gefäßen, sind bei der WBRT jedoch massiver als bei gezielten Radiotherapien wie SRS und SRT.
Chemotherapie
Das Ansprechen auf die Chemotherapie ist bei Gehirnmetastasen sehr variabel. Aufgrund der Blut-Hirn-Schranke ist die Response-Rate insgesamt limitiert. Die Response-Raten können vor allem bei kleinzelligem Lungenkrebs (SCLC), Hodenkrebs und NSCLC (nicht-kleinzelliger Lungenkrebs) zwar hoch sein, aber in klinischen Studien konnte kein klarer und robuster Überlebensvorteil nachgewiesen werden.
Zielgerichtete Therapien
TKIs oder Immunotherapeutika können die Blut-Hirn-Schranke in bestimmten Fällen gut überwinden und erzielen einzeln und in Kombination mit anderen therapeutischen Maßnahmen passable bis sehr gute Ergebnisse. Bei der Behandlung von Melanom-Metastasen konnten die TKIs Vemurafenib (BRAF-Inhibitor) und Dabrafinib (MEK-Inhibitor), eine deutliche Verkleinerung der Läsionen bewirken. Die Overall-Response war bei der BRAF und MEK-Inhibition bei Gehirnmetastasen zwar ähnlich gut wie extrakraniell, hielt im Median aber nur 5-6 Monate im Vergleich zu 12-14 Monaten bei Patienten ohne Gehirnmetastasen an.
EGFR und ALK-Inhibitoren
Der EGFR-Inhibitor Osimertinib erreichte bei der Behandlung von intrakraniellen NSCLC-Metastasen eine geradezu dramatisch gute Response bei einem Patienten in einem bereits schlechten Zustand. Alectinib, ein ALK-Inhibitor, zeigte bei Crizotinib-resistenten Gehirnmetastasen eine gute Wirksamkeit. Unter der Therapie von Gehirnmetastasen durch NSCLC kam es unter Alectinib nur bei 9,4% der Patienten zu einer Tumorprogression innerhalb von 30 Monaten, wohingegen unter Crizotinib im gleichen Behandlungszeitraum eine Progression bei 41,4% der Patienten verzeichnet werden musste.
Checkpoint-Inhibitoren
Ipilimumab zeigte bei einem Teil von Patienten mit Melanom induzierten Gehirnmetastasen (insbesondere bei asymptomatischen kleinen Läsionen) Aktivität. Bei der Kombination von Nivolumab und Ipilimumab verbesserten sich Clinical Response (CR) Progression Response (PR) bei der gleichen Metastasen-Art erheblich.
Pembrolizumab wirkte bei einigen Patienten mit Gehirnmetastasen durch NSCLC gut. Die Metastasen durch Melanome sprachen nur zum Teil auf Pembrolizumab an.
Bei Non-squamous (ns) NSCLC verursachten Gehirnmetastasen erzielte Bevacizumab in Kombination mit Cisplatin (CP) in der Erstlinienbehandlung eine Response-Rate von über 60%. Auch bei bereits mehrfach vorbehandeltem metastasierendem Brustkrebs bewirkte Bevacizumab eine deutliche zum Teil bis zu 100ige Volumenabnahme der Gehirnmetastasen. Eine gute Wirksamkeit zeigte Bevacizumab auch bei Gehirnmetastasen durch NCCLC und Kolorektalem Karzinom (CRC).
Vorbeugung möglich?
Erste Untersuchungen im Mausmodell zeigen, dass Wirkstoffe, wie zum Beispiel Nintedanib, anti-Ang-2/anti-VEGF-A oder PI3K/mTOR Inhibitor, möglicherweise die Ansiedlung von Metastasen im Gehirn verhindern und so eine echte Vorbeugung gegen die Entstehung von Gehirnmetastasen sein könnten.
Fazit
Eine multidisziplinäre Aufarbeitung jeden Einzelfalls ist unerlässlich, um bei Gehirnmetastasen gute Ergebnisse zu erzielen. TKI und Immunotherapeutika zeigen in Einzel- und Kombinationstherapien mit anderen Wirkstoffen teilweise sehr gute Response-Raten. Allerdings sollte die Patientenauswahl für diese Präzisionstherapeutika in vielen Fällen noch verfeinert werden, um die „Trefferquote“ der zielgerichteten Wirkstoffe zu erhöhen. Hierfür ist die molekulare Untersuchung des Metastasen-Gewebes entscheidend, weil sich Primärtumor und Metastasen im Gehirn hier unterscheiden können.