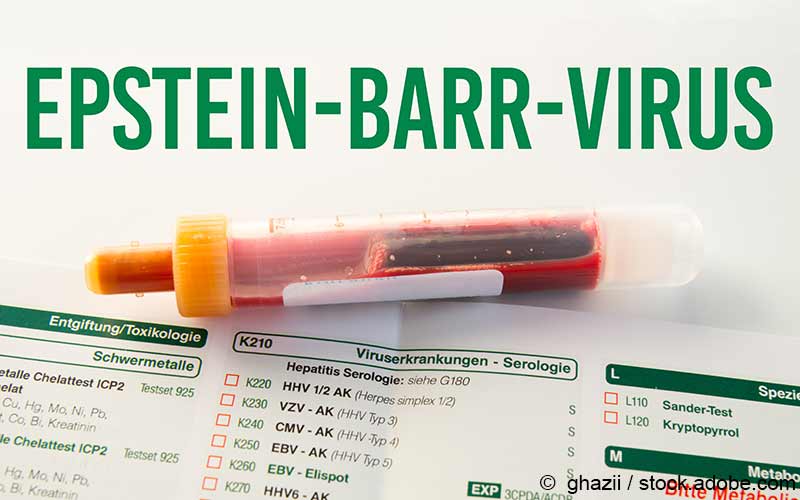
Nach Mitteilung der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft (AkdÄ) kam es bei einer 68-jährigen Patientin im Zusammenhang mit einer Adalimumab-Therapie zu einer EBV-induzierten Meningoenzephalitis. Die Frau litt seit Jahren an einer seropositiven rheumatoiden Arthritis (CCP-AK-positiv). Weitere Vorerkrankungen waren arterielle Hypertonie, Autoimmunthyreoiditis, intermittierende Hepatopathie unklarer Genese, allergisches Asthma bronchiale und Osteopenie. Zudem erkrankte die Frau unter immunsuppressiver Therapie an einer Lamblieninfektion in der Türkei.
Zur Behandlung der rheumatoiden Arthritis erfolgten mehrfach Radiosynoviorthesen. Des Weiteren erhielt sie über mehrere Jahre Methotrexat, teilweise in Kombination mit Chloroquin. Wegen einer Hepatopathie musste die Methotrexat-Gabe jedoch beendet werden. Auf den alternativen Therapieversuch mit Leflunomid reagierte die Patientin unverträglich, Hydroxychloroquin wirkte nur unzulänglich. Sechs Wochen vor dem unerwünschten Ereignis wurde eine Basis-Therapie mit zweimal wöchentlich 40 mg Adalimumab begonnen. Diese musste jedoch Diarrhoe-bedingt nach viereinhalb Monaten abgebrochen werden. Letztlich nahm die Frau täglich 500 mg Naproxen, 10 mg Lisinopril und 75 µ L-Thyroxin ein.
Einweisung: Verdacht auf Epilepsie
Zunächst bemerkte die Frau ein unkontrolliertes Zittern beider Beine und Schreibschwierigkeiten (eine Woche vor Klinikeinweisung). Am Vortag der Krankenhaus-Aufnahme fiel fluktuierend eine verwaschene Sprache auf. Am Einweisungstag verlor die Patienten auf dem Sofa sitzend plötzlich das Bewusstsein. Nachdem sie wieder zu sich kam, bemerkte sie Schmerzen am rechten Zungenrand. Kurze Zeit später konnte sie sich nicht mehr artikulieren. Fremdanamnestisch reagierte die Frau mit geöffneten Augen für einige Minuten lang gar nicht. Die stationäre Aufnahme erfolgte in der Annahme eines komplex-fokalen oder auch generalisierten Krampfanfalls.
Diagnose: Meningoenzephalitis durch Epstein-Barr-Virus
Laut neurologischem Aufnahmebefund bestanden eine leichtgradige Hemiparese rechts, eine leichte Dysarthrie, eine verminderte Auffassungsfähigkeit, Störungen des Kurzzeitgedächtnisses sowie ein Zungenbiss rechts lateral. Ein Meningismus bestand nicht. Internistisch gab es keine Auffälligkeiten. Im zerebralen MRT zeigten sich kleinere frische Diffusionsstörungen im Versorgungsgebiet der A. cerebri anterior beidseits sowie eine fulminante Leukenzephalopathie. Anzeichen für Gefäßverschlüsse gab es nicht. Die EEG-Untersuchung ergab ein unregelmäßiges Alpha-EEG mit Vigilanzschwankungen. Laborchemisch fiel eine Leukozytose bis maximal 14,6/nl auf. Im Liquor bestand eine Pleozytose mit 175 Zellen. Der Zerfall der Zellen erlaubte keine Differenzierung. Das Gesamteiweiß im Liquor lag bei 615 mg/dl. Eine intrathekale IgG-Synthese wurde nicht nachgewiesen, der Albuminquotient war unauffällig. Die EBV-PCR im Liquor war mit einem EBV-Antikörperindex von 4,3 (normal unter 2) positiv. Als Begleitphänomen konnten im Liquor geringe Titer von Borrelien-IgG und IgM sowie Masernantikörpern nachgewiesen werden. Als Diagnose wurde eine Meningoenzephalitis durch Epstein-Barr-Virus gestellt.
Therapie: Aciclovir, Ceftriaxon Methylprednisolon, Levetiracetam und Clobazam
Die Ärzte begannen unverzüglich (noch vor Erhalt der virologischen Befunde) mit einer kalkulierten Therapie mit Aciclovir, Ceftriaxon und Methylprednisolon. Antikonvulsiv erhielt die Patientin Levetiracetam und zeitlich begrenzt Clobazam. Darunter wurden keine weiteren Anfälle mehr beobachtet. Im weiteren Behandlungsverlauf besserte sich der Allgemeinzustand und die neurologischen Ausfallerscheinungen zeigten sich rückläufig. Die Veränderungen in der zerebralen Bildgebung besserten sich ebenfalls. Mit der Empfehlung der vorsichtigen Belastung bis zur vollständigen Regeneration wurde die Patientin in die ambulante neurologische Behandlung entlassen.
Nach etwa eineinhalb Jahren kam es zu einem operationsbedürftigen Rezidiv der rheumatoiden Arthritis. Neben der operativen Versorgung einzelner Gelenke wurde immunsuppressiv Tocilizumab eingesetzt. Damit konnten eine stabile Remission und ein Wohlbefinden der Patientin erreicht werden.
Differenzialdiagnose Meningoenzephalitis bei Anti-TNFα-Therapie
Bei rheumatoider Arthritis besteht nahezu zwingend ein erhöhtes Risiko für schwerwiegende - insbesondere opportunistisch virale und durch Mykobakterien verursachte - Infektionen. Metaanalysen ergaben, dass TNFα-Antagonisten wie Adalimumab dieses Risiko nochmals steigern. TNFα spielt unter anderem bei der Kontrolle latenter mykobakterieller und viraler Infektionen eine wichtige Rolle. Während der Behandlung mit TNFα-Inhibitoren ist einer Reaktivierung dieser Infektionen möglich. Daher müssen die in der Fachinformation aufgeführten Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen zwingend beachtet werden.
Bei unklaren neurologischen Symptomen während einer Anti-TNFα-Behandlung sollten infektiöse Meningoenzephalitiden (auch seltener Genese) differenzialdiagnostisch in Erwägung gezogen und im Rahmen des Spontanmeldesystems gemeldet werden./krankheiten/pfeiffersches-druesenfieber-infektioese-mononukleose














