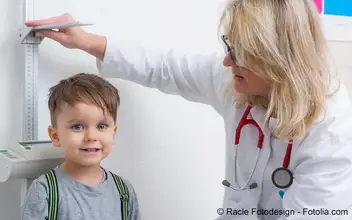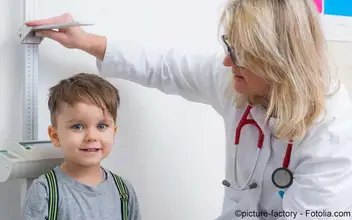Die Stiftung Kindergesundheit an der Kinderklinik der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München hat in Zusammenarbeit mit der Stiftung „Die Gesundarbeiter – Zukunftsverantwortung Gesundheit“, der Krankenkasse vivida bkk, MSD Sharp & Dohme GmbH und Novartis Pharma GmbH den ersten Kindergesundheitsbericht herausgegeben. 30 Jahre nach der Unterzeichnung der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen (United Nations, UN) wurde die aktuelle Lage der körperlichen und seelischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland bewertet. In elf Kapiteln werden fakten- und wissenschaftsbasiert für die Kindergesundheit wichtige Aspekte sowie Erfolge und Chancen beleuchtet. Ziel ist es, mit dem Bericht der Öffentlichkeit und insbesondere auch der Politik und im Gesundheits- und Bildungswesen „eine sachlich neutrale und aktualisierte Informationsbasis und Orientierung“ zu bieten.
Zwar zeigt der Bericht einerseits, dass Kinder und Jugendliche in Deutschland sehr gute Gesundheitschancen haben, andererseits werden auch tägliche Verstöße gegen die Kinderrechtskonvention insbesondere aufgrund struktureller Defizite offengelegt.
Fehlende Ressourcen für Gesundheitsversorgung
Die Pädiatrie stellt ein komplexes Fachgebiet mit einer sehr heterogenen Patientengruppe dar, das ein breites Spektrum Krankheitsbilder abdeckt. Die Kinder und Jugendlichen benötigen sowohl eine individualisierte medizinische Behandlung als auch eine starke persönliche Zuwendung, was die Pädiatrie personal- und kostenintensiv macht. Da etwa 70% bis 80% der Krankenhausaufnahmen von Kindern und Jugendlichen ungeplant aufgrund akuter Erkrankungen erfolgen, sind die Vorhaltekosten besonders hoch (40% des Budgets, bei Erwachsenen etwa 25%).
Laut des Kindergesundheitsberichts werden diese Mehrkosten durch das bestehende Finanzierungssystem mit den Fallpauschalen nicht ausreichend abgebildet und refinanziert, sodass pädiatrische Abteilungen dauerhaft defizitär seien und in vielen Fällen durch andere klinische Fachbereiche querfinanziert werden müssten. Die Autoren fordern daher die Unterfinanzierung zu beenden und die personelle Aufstellung zu stärken und zu fördern, um eine konsequente Umsetzung des Kinderrechts auf Gesundheit zu ermöglichen.
Chronische und seltene Erkrankungen
Laut der KiGGS-Studie des Robert Koch-Instituts (RKI) ist in Deutschland jedes sechste Kind zwischen 0 und 17 Jahren chronisch krank. Besonders häufig treten dabei Erkrankungen der atopischen Trias (Neurodermitis, Asthma, Allergie), aber auch andere Krankheiten wie Adipositas, Diabetes mellitus Typ 1, Herzkrankheiten, Migräne, Fieberkrämpfe oder Epilepsie auf. Dem Kindergesundheitsbericht zufolge zeigen sich eine Fragmentierung der Versorgungsangebote, eine unzureichende Qualität und Unterversorgung. Die Unzufriedenheit der Patienten und ihrer Eltern steigt mit der Schwere der Erkrankung. Problematisch sind unter anderem zu geringe Kapazitäten, eine mangelnde Vernetzung der Behandler und ein unzureichender Transitionsprozess, wie ihn beispielsweise die Deutsche Diabetesgesellschaft Mitte des Jahres bemängelte. Derzeit verlieren rund 40% der Patienten bei dem Übergang von der pädiatrischen zur Erwachsenenversorgung den Anschluss.
Auch bei seltenen Erkrankungen ist die Versorgung unzureichend. Sie stellen eine besondere Herausforderungen für Ärztinnen und Ärzte dar, die multiprofessionelle Begleitung ist kostenintensiv. Die Autoren fordern die Förderung der interdisziplinären Vernetzung, Forschung und Weiterbildung.
Vorsorge und Früherkennung
Der Bericht zeigt, dass Vorsorgeuntersuchungen in Deutschland im frühen Kindesalter (U-Untersuchungen) weiterhin sorgfältig wahrgenommen werden. Das galt auch während der Corona-Pandemie unter Beachtung der geltenden Sonderregelungen. Bei den Jugenduntersuchungen (J1 + J2) besteht allerdings seit Längerem Optimierungsbedarf. Die Inanspruchnahmerate der J-Untersuchungen liegt derzeit im Bundesdurchschnitt unter 50%. Daher wird eine Kampagne zur nachholenden Durchführung von J1-Untersuchungen 2022/23 gefordert, auch um Pandemie-bedingte Problemen und Risiken erkennen zu können.
Impfungen
Impfungen zählen zu den wichtigsten Präventionsmaßnahmen gegen Infektionskrankheiten und deren Folgeerkrankungen. Die jährliche Impfquotenanalyse des Robert-Koch-Instituts (RKI) für empfohlene Impfungen bei Kindern und Jugendlichen aus Daten der Schuleingangsuntersuchungen sowie Abrechnungsdaten der Kassenärztlichen Vereinigungen (KV) zeigt über die letzten Jahre eine zunehmende Impfmüdigkeit. Sowohl Erwachsene als auch Kinder werden häufig zu spät und zu wenig geimpft. Bei keiner Impfung wurde in Deutschland bisher ein national bzw. international gesetztes Impfquotenziel erreicht. Eine große Impflücke besteht insbesondere bei der Impfung von Jugendlichen gegen Humane Papillomviren (HPV).
Die Autoren des Kindergesundheitsberichts fordern daher ein weiter verbessertes Impfquotenmonitoring, bessere Aufklärung, Gesundheitskompetenz und Information sowie Impfangebote an Schulen.
Verschlechterung der mentalen Gesundheit
Die Corona-Pandemie hat die mentale Gesundheit der Kinder und Jugendlichen in Deutschland stark belastet. Im Rahmen der COPSY-Studie, in der über 2.000 Familien drei Mal zwischen 2020 und 2021 befragt wurden, zeigte sich eine Zunahme psychischer Auffälligkeiten. Zu Beginn gaben 71% der Kinder an, sich durch die Veränderungen während der Pandemie belastet zu fühlen, bei der zweiten Befragung stieg dieser Wert auf 83% und bei der dritten Befragung 1,5 Jahre nach dem Pandemiebeginn fühlten sich noch 82% der Kinder belastet. Symptome von Angststörungen waren zu diesem Zeitpunkt noch fast doppelt so häufig wie vor der Pandemie (27% vs. 15%), während depressive Symptome zur zweiten Befragung zum Jahreswechsel 2020/2021 am höchsten waren (15%) und danach wieder fast auf den präpandemischen Stand zurückgingen (11%). Daneben traten auch vermehrt psychosomatischen Beschwerden, wie Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Einschlafprobleme oder Gereiztheit auf. Die psychische Belastung betraf insbesondere sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche.
Die Autoren fordern daher eine verbesserte Versorgung mit Verkürzung der Wartezeiten auf einen Therapieplatz, beispielsweise durch die temporäre Einbeziehung von Privatpraxen oder klinisch tätigen Psychotherapeuten und Psychiatern, eine Förderung der Angebote und einer niedrigschwelligen schulischen Anbindung sowie den Ausbau evidenzbasierter Maßnahmen in der Kinder- und Jugendhilfe sowie ein Schulfach zu Gesundheit.
Ernährung und Bewegung
Die Zahl der übergewichtigen und adipösen Kinder nimmt stetig zu. Dieser Anstieg wurde durch die Umstände der Pandemie noch verstärkt. Hinzu kommt ein Bewegungsmangel bei fast 70% der Kinder und Jugendlichen in Deutschland. Die Autoren des Kindergesundheitsberichts fordern zum einen die verpflichtende Einhaltung der DGE-Standards für Ernährung in Kita- und Schulverpflegung sowie ein Marketingverbot für an Kinder und Jugendliche gerichtete, ungesunde Produkte. Zudem sollen zuckerhaltige Getränke in Abhängigkeit von der Höhe des Zuckergehaltes besteuert werden. Für eine ausreichende Bewegung seien eine intersektorale Zusammenarbeit, eine bewegungsanregende räumliche und soziale Umwelt sowie niederschwellige und vielfältige Bewegungsangebote nötig.
Mediennutzung
Auch die Mediennutzung bei Kindern und Jugendlichen nimmt, insbesondere seit der Pandemie, an Dauer und Häufigkeit zu. Etwa 3% bis 5% der deutschen Kinder und Jugendlichen weisen laut der deutschen Suchtkommission ein krankhaftes Verhalten bei der Nutzung digitaler Medien auf und 8,4% der 12- bis 17-Jährigen sind von einer pathologischen Computerspiel- oder internetbezogenen Störung betroffen Die Verfasser des Kindergesundheitsberichts fordern eine Präventionsoffensive und Förderung der Medienkompetenz, da die Mediennutzung einen nicht zu unterschätzender Einflussfaktor auf die Kindheit und Adoleszenz darstelle. Ebenso seien Mediensuchtscreenings und weiterführende Datenerhebungen in diesem Bereich nötig.
Sozioökonomischer Status beeinflusst Gesundheit
Der Soziökonomische Status der Kinder und Jugendlichen hat einen erheblichen Einfluss auf ihre psychische und physische Gesundheit. Nach Auswertungen des Kindergesundheitsberichts rauchen Mütter dieser Kinder öfter während der Schwangerschaft und stillen seltener, die Kinder werden ungesünder ernährt und leiden häufiger an chronischen Erkrankungen, Entwicklungsstörungen und psychischen Auffälligkeiten. Ergebnisse aus Daten des Sozioökonomischen Panels (SOEP), der größten und am längsten laufenden multidisziplinären Langzeitstudie in Deutschland, zeigen dass sich dieser Zusammenhang zwischen sozioökonomischem Status und allen untersuchten Indikatoren der Gesundheit (subjektiver Gesundheitszustand, Stillverhalten, Krankenhausaufenthalte, Erkrankungen) in den letzten 10 Jahren nicht geändert hat.
Es müsse ein zentrales Anliegen jeder Sozial- und Gesundheitspolitik sein, die sozioökonomische Diskrepanz der Gesundheitschancen bei den heranwachsenden Generationen mit noch stärkeren Kraftanstrengungen zu verringern. Dafür sei ein ressortübergreifender Aktionsplan notwendig, heißt es in dem Bericht.
Klimawandel
Kinder und Jugendliche stellen eine besonders vulnerable Gruppe in Bezug auf gesundheitlichen Folgen des Klimawandels dar. Es wird eine Zunahme von von vektorübertragenen Erkrankungen (z.B. FSME) sowie allergischen bzw. respiratorischen Erkrankungen durch eine vermehrte Pollenmenge und längere Pollenflugzeit erwartet. Zu befürchten sind auch die Ausbreitung nichtheimischer Arten mit hohem allergischen Potenzial, wie der Ambrosia artemisiifolia (Beifußblättriges Traubenkraut) sowie Belastungen durch Extremwetterereignisse (Hitze) und UV-Strahlung. Daher müsse der Kampf gegen den Klimawandel bei jeglichem politischen Handeln berücksichtigt und Untersuchungen zur Auswirkungen auf Kindergesundheit gefördert werden.
Die Stiftung Kindergesundheit plant in Zukunft weitere Berichte zur Überprüfung der Entwicklungen im pädiatrischen Gesundheitssektor.