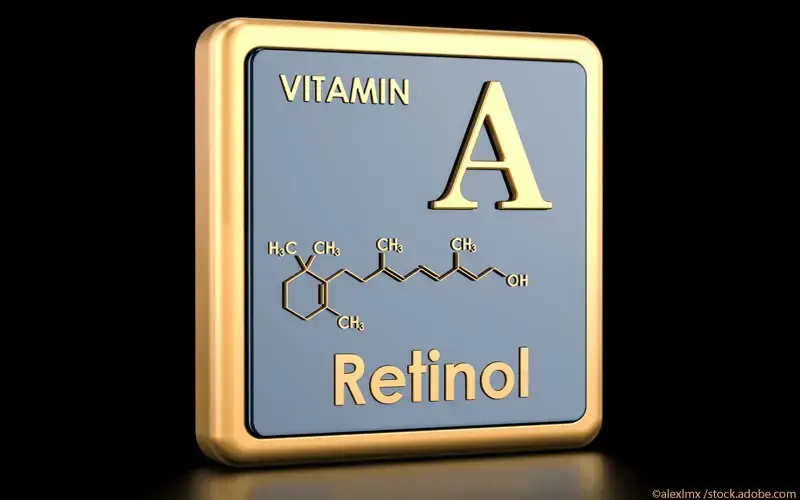Das Trockene Auge (Keratoconjuctivitis sicca, Sicca-Syndrom, Dry-Eye-Syndrom) ist eine symptomatische und multifaktorielle Erkrankung der Augenoberfläche, die durch einen Verlust der Homöostase des Tränenfilms und der Hyperosmolarität charakterisiert ist [1]. Es kommt zu Entzündungen und Schädigungen der Augenoberfläche und neurosensorischen Abnormitäten, was zu Einschränkungen täglicher Aktivitäten, verminderter Vitalität und schlechter allgemeiner Gesundheit führt. Der erhöhte Leidensdruck der Betroffenen kann sogar eine Depression auslösen.
Aufbau und Aufgaben des Tränenfilms
Der Tränenfilm ist mehrschichtig aufgebaut und besteht aus Lipiden, Wasser und Muzin (Schleim). Die Lipidschicht ist die oberste Schicht des Tränenfilms. Sie besteht unter anderem aus Cholesterin, Phospholipiden und Triglyceriden und dient dazu, den Tränenfilm vor Verdunstung zu schützen.
Die mittlere Schicht des Tränenfilms ist die wässrige Schicht, die zum größten Teil aus Wasser besteht . Weiterhin enthält die Flüssigkeit unter anderem Glucose, Sauerstoff, Immunglobuline der unspezifischen Immunabwehr, Enzyme und Wachstumsfaktoren. Zwischen der wässrigen Schicht und der Hornhautoberfläche befindet sich die Muzinschicht. Muzine sind chemisch betrachtet Glykoproteine. Sie wirken protektiv und spielen eine Rolle bei der Barrierefunktion. Sie sorgen unter anderem dafür, dass Bakterien und Fremdkörper nicht in die Epithelzellen eindringen.
Ein intakter Tränenfilm sorgt für eine Befeuchtung des Auges, versorgt die Cornea mit Sauerstoff und Nährstoffen und schützt vor Infektionen. Ein Augenarzt bzw. eine Augenärztin kann feststellen, ob die Beschwerden auf eine Störung der wässrigen Schicht des Tränenfilms oder der Lipidschicht zurückzuführen sind. Danach richtet sich die Therapie.
Unterformen des Trockenen Auges
Nach Leitlinie des Berufsverbands der Augenärzte Deutschlands (BVA) und der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft (DOG) gibt es mehrere Unterformen dieser Augenerkrankung:
- Störungen der wässrig-muzinösen Tränenfilmanteile (hyposekretorische Form) durch zu geringe Produktion von Tränenflüssigkeit
- Störungen der Lipidanteile des Tränenfilms (hyperevaporative Form, z. B. Blepharitis) durch zu schnelle Verdunstung der Tränenflüssigkeit
- Kombinierte Störungen
Risikofaktoren
Als häufigster Risikofaktor für die Entstehung eines Trockenen Auges wird die Meibom-Drüsen-Dysfunktion angesehen. Die chronische Störung kann charakterisiert sein durch eine hypo- und hypersekretorische Form. Weitere Risikofaktoren sind Alter, weibliches Geschlecht, Androgen-Mangel (durch Schwangerschaft, Stillzeit oder Menopause), Rosazea, atopische Dermatitis, Diabetes mellitus, Vitamin-A-Mangel, hämatopoetische Stammzelltransplantationen, Bestrahlungen des Kopfes, Umweltfaktoren (Zigarettenrauch, trockene Luft), langanhaltende Bildschirmarbeit, Medikamente (z. B. Antihistaminika, Psychopharmaka, Betablocker, orale Kontrazeptiva, Anticholinergika, postmenopausale Östrogentherapie), genetische Prädisposition, ophthalmologische Faktoren wie Lidfehlstellungen, Hornhauterkrankungen, Verätzungen oder Tragen von Kontaktlinsen.
Behandlung
Die Behandlung richtet sich nach der Ursache und dem Krankheitsstadium. Wenn die Beschwerden auf eine Störung der Lipidschicht zurückzuführen sind, empfehlen sich Tränenersatzstoffe mit einem Zusatz von Trigylceriden oder Phospholipiden. Derartige Zubereitungen sind dickflüssiger als die natürlichen Tränen und verweilen dementsprechend länger auf dem Auge. Bei leichten Beschwerden können zunächst niedrig visköse, bei stärkeren Beschwerden hoch visköse Zubereitungen eingesetzt werden. Da es bei deren Anwendung allerdings zu einer Sichttrübung kommt, sollten solche Präparate eher zur Nacht appliziert werden. Je nach Beschwerden und Befund werden verschiedene Therapien innerhalb der Selbstmedikation empfohlen. Dabei sind Tränenersatzstoffe Mittel der ersten Wahl.